|
Wir haben die beiden
großen Eingriffe des Königs in die Finanz- und Militärverfassung
des Staats etwas ausführlicher geschildert, sowohl weil sie am
klarsten zeigen, was es mit dem aufgeklärten Despotismus dieses
Fürsten auf sich hat. als auch weil sich an ihnen das Wesen der
Großen Männer studieren läßt. die regelmäßig das größte Unheil
anrichten, wenn sie anfangen, die „Geschichte zu machen". Wir
haben aber schon gesehen, daß Friedrich im allgemeinen viel
vernünftiger war als seine Bewunderer, und daß er sich gar wohl in
die ökonomischen Lebcnsbedingungen zu finden wuBtc, die ihm
gegeben waren. Diesen Bedingungen entsprach es durchaus, daß er in
seiner Wirtschaftspolitik einem platten Merkantilismus huldigte.
Die merkantilistische Theorie war das ideologische
Wirtschaftssystem des fürstlichen Absolutismus, der sich aus dem
Warenhandel und der Warenproduktion entwickelt hatte. Die
ökonomischen Zustände, welche sie widerspiegelte, ergaben ihre
einseitige Betonung des Handels und der Ver-arbcitungsgewerbe.
ihre Überschätzung der Bevölkerungsdichtigkcit und des baren
Geldes als der Ware aller Waren, und endlich ihre Forderung, daß
die neu entstandene Staatsgewalt alles zu fördern habe, woraus und
weswegen sie entstanden sei: also Handel und Gewerbe, die
Vermehrung der Volkszahl und der Geldmasse. Aber der Hammer
schlägt nicht nur den Amboß. sondern der Amboß schlägt auch den
Hammer: die Praxis erzeugt immer erst die Theorie, aber die
Theorie gestaltet dann auch die Praxis. Das Merkantilsystem wurde
für den Absolutismus ein Hebel seiner dynastischen Interessen: es
ermöglichte ihm das Sophisma, wonach Geldbesitz und Reichtum einer
Nation ein und dasselbe seien, und damit hatte er gewonnenes Spiel
für die fiskalische Ausbeutung des Volkes. Je mehr Geld die
Fürsten für ihre Heere und Höfe ins Land ziehen und im Lande
behalten konnten, um so reicher wurde das Volk, und auch die
sinnloseste Verschwendung war unbedenklich, „wenn das Geld nur im
Lande blieb". Überall, wo der Warenhandel und die
Warenproduktion sich naturwüchsig in bedeutendem Umfange
entwickelt hatten, so beispielsweise in Frankreich, konnte das
Merkantilsystem nicht so leicht entarten, weil die Praxis
unausgesetzt die Theorie im Zaume hielt; Colbcrt, der bedeutendste
Staatsmann des Merkantilismus, wußte gar wohl, daß es „im Staate
nichts Köstlicheres als die Arbeit der Menschen" gebe, und eine
Glanzseite seiner Verwaltung war der Bau von Landstraßen, um den
Verkehr zu fördern. In Deutschland dagegen hatte der Absolutismus
mehr einen feudalen als einen kapitalistischen Ursprung, und so
konnte oder mußte aus der ökonomischen Vernunft der
merkantilistischen Theorie um so leichter eine absolutistische
Unvernunft werden. Friedrich verfocht die "ebenso einleuchtende
wie wahre" Ansicht: „Nimmt man alle Tage Geld aus einem Beutel und
steckt nichts dagegen wieder hinein, so wird er bald leer werden",
was denn eben die platteste Auffassung des Merkantilismus war, und
er ließ die Landstraßen verfallen, damit ausländische Reisende um
so länger aufgehalten würden, und um so viel mehr Geld im Lande
verbrauchten. Noch weit bezeichnender, als der Vergleich zwischen
Colbert und Friedrich, ist der Briefwechsel, den der König im
Jahre 1765 mit der Kurfürstin-Regentin Maria Antonia von Sachsen
wegen der gegenseitigen Handelssperre führte. Sachsen war unter
den deutschen Teilstaaten der ökonomisch entwickeltste; die
Leipziger Kaufleute verlangten schon den ganz freien Handel, und
so schrieb die Kurfürstin an Friedrich: „Unser großes Prinzip ist
die Freiheit des Handels und die Reziprozität der Vorteile." Aber
Friedrich weiß darauf nichts zu erwidern als einige sentimentale
Phrasen über die schlimmen Seiten von Gold und Silber, die leider
notwendige Übel geworden seien. Und solche Notwendigkeit lege die
Pflicht auf, diese an sich gemeinen und verächtlichen Metalle zu
suchen. Er blieb der Ansicht seines Launay, daß die Schädigung des
Auslands der Vorteil des Vaterlandes sei, eine Ansicht, die
freilich auch noch Voltaire vertreten hatte, aber die Mirabeau
doch schon ,,monströs und eines Staatsmanns im elften Jahrhundert
würdig" nennt.
Gerade im brandenburgisch-preußischen Staat war der
Merkantilismus nicht aus der ökonomischen Entwicklung erwachsen,
sondern wurde die ökonomische Entwicklung nach den
rnerkantilistischen Lehren zu leiten gesucht. Als der
Merkantilismus im westlichen Europa längst in voller Blüte stand,
gab die Vertreibung der Hugenotten aus Frankreich dem Kurfürsten
Friedrich Wilhelm kurz vor seinem Tode die erste namhafte
Gelegenheit, große Kapitalien ins Land zu ziehen. Nicht ein
religiöser, sondern ein ökonomischer Beweggrund veranlaßte ihn,
die vertriebenen Glaubensgenossen in seine Staaten zu laden. Er
hatte schon vorher einzelne kleine Versuche mit einer Seifen- und
einer Zuckersiederei, mit einer Porzellanbäckerei gemacht, aber
die ersten Fabriken und Manufakturen in größerem Umfange datieren
erst aus der Zeit der französischen Einwanderung. Indessen auf
diesem agrarisch-feudalen Boden mit seinen verkümmerten
Kleinstädten blieben sie ein künstliches Gewächs, das im
Treibhause der rnerkantilistischen Lehren mühsam gepflegt werden
mußte. Es stimmte äußerlich vortrefflich mit diesen Lehren, daß
der wachsende Militärstaat nach immer mehr Geld und Menschen
schrie, aber dieser Militärstaat verschlang den Zuwachs an Geld
und Menschen, den das Merkantilsystem für die Belebung von Handel
und Industrie forderte, für seine Kanonen und seine Rekruten. Für
Handel und Industrie blieb wenig oder nichts übrig, während gerade
für sie, wenn sie in dem ungünstigen Boden der ostelbischen
Landschaften gedeihen sollten, viel oder alles hätte aufgewandt
werden sollen. Um aber die künstliche Pflanze dennoch am Leben zu
erhalten, schenkte ihr der preußische Absolutismus seine
liebevolle Sorgfalt in allerlei schönen Dingen, die ihn nichts
kosteten: in Monopolen und Privilegien, in Aus- und
Einfuhrverboten, in Lohn- und Preis-Taxen. in technischen
Betriebsvorschriften, kurz in jenem verworrenen Chaos eines
entarteten und seinem ursprünglichen Sinne gänzlich entfremdeten
Merkantilismus, das in Mirabeau einen so beredten Ankläger
gefunden hat. Er kann es nicht bitter genug tadeln, daß der König
im Jahre 1766 die Einfuhr von nicht weniger als 490 Artikeln
einfach verbot oder im Jahre 1774 auf die Ausfuhr der Wolle
Todesstrafe setzte, aber er übersah, daß dieser besondere
Merkantilismus eben die ideologische Wirtschaftsform dieses
besonderen Militärstaates war und sein mußte.
Friedrichs ökonomische Einsichten und Kenntnisse hätten
ungleich bedeutender sein können als sie waren, und es wäre doch
nicht anders gewesen. So viel sah der König schon ein, daß die
feinere Gewebe-lndustrie der Höhepunkt der damaligen ökonomischen
Entwicklung war — sie war für das achtzehnte Jahrhundert, was die
Eisen- und Kohlen-Industrie für das neunzehnte Jahrhundert ist —
und er handelte im eigentlichen Geiste des Merkantilsystems, wenn
er gleich nach seinem Regierungsantritt im Generaldirektorium ein
eigenes Kommerzien- und Manufakturdepartement einrichtete, dem er
besonders anbefahl, eine neue Industrie der seidenen Zeuge, der
französischen Gold- und Silberstoffe etc. einzuführen. Aber
während Frankreich und England die größten Opfer für ihre
Seidenindustrie brachten, hat Friedrich während seiner ganzen
Regierung nur etwa zwei Millionen Taler auf dies verzärtelte
Lieblingskind gewandt(1). Er gab ihm wenig zu essen und zu
trinken; dafür hütete er um so ängstlicher seinen dünnen
Lebensfaden, indem er es in festgeschlossenen Räumen auf Schritt
und Tritt gängelte. Bei dieser ihm so ans Herz gewachsenen,
schließlich aber doch abgestorbenen Industrie ist es klar, daß der
König nicht mehr tat, weil er nicht mehr tun wof/ie. sondern weil
er nicht mehr tun (tOMHfe. Die Mittel fehlten ihm mehr als die
Einsicht. In dem feudalen Militärstaate Preußen mußte der
Merkantilismus ebenso auf die mittelalterlichen Bann- und
Zwangsrechte zurückschlagen, wie er sich in dem bürgerlichen
Industrielande England zum Freihandel entwickeln mußte.
Im Grunde tut die friderizianische Legende dem Könige bitteres
Unrecht, wenn sie an allen zehn Fingern die bei alledem unzähligen
Millionen aufzählt, die er namentlich nach dem Siebenjährigen
Kriege in „landesväterlicher Fürsorge" für die Hebung der
allgemeinen Wohlfahrt ausgegeben haben soll. Hätte der König
wirklich die freie Verfügung über so bedeutende Mittel gehabt, wie
er angeblich mit verschwenderischer Hand ausgestreut hat, so wäre
seine Wirtschaftspolitik von dem Vorwurfe ungewöhnlicher
Beschränktheit schwer freizusprechen. Tatsächlich hat er aber in
den 23 Jahren von 1763 bis 1786 nach der Berechnung des Ministers
v. Hertzberg, des verhältnismäßig sachkundigsten Urteilers, nicht
mehr als 24.399.838 Taler für jenen Zweck ausgegeben. Wir sagen:
des verhältnismäßig sachkundigsten Urteilers, denn wenngleich
Hertzberg der bedeutendste und erfahrenste Minister in Friedrichs
Spätzeit war, so gehörte es doch zu den unverbrüchlichen
Grundsätzen des ersten Dieners des Staates, daß kein Minister eine
volle Einsicht in die Lage des Staatshaushaltes gewinnen durfte.
Alle Überschüsse der jährlichen Staatseinkünfte über die
etatmäßigen Ausgaben sowie gewisse Regalien und Steuern flössen in
die sogenannte Dispositionskasse, die der König allein mit einigen
untergeordneten Werkzeugen verwaltete. Eine ziffernmäßig genaue
Übersicht der fri-dcrizianischen Finanzwirtschaft ist dadurch sehr
erschwert, wenn nicht ganz unmöglich gemacht, allein die Frage,
auf die es uns hier allein ankommt, die Frage nach den
Aufwendungen dieses aufgeklärten Despoten für das. was seine
Bewunderer seine „sozialistische Staatshilfe" nennen. läBt sich
wenigstens für die Zeit nach Einführung der Regie, also für die
letzten zwanzig Jahre Friedrichs, wenn nicht mit absoluter, so
doch mit relativer Sicherheit beantworten.
Er selbst gibt die jährlichen Staatseinkünfte für diese Zeit
auf 21.700.000 Taler an. Sie werden von keiner Seite höher, von
den meisten, sonst sachkundigen, Urteilern wie Boyen, Krug und
Riedel etc. erheblich niedriger geschätzt. Jedenfalls sind sie
erst in den letzten Jahren des Königs so , hoch gestiegen, der
starken Akzise-Ausfälle in den Hungerjahren 1770 und 71. in dem
Kriegsjahre 1778 nicht erst zu gedenken. Lassen wir es aber bei
der von Friedrich angegebenen Ziffer für den ganzen Zeitraum
bewenden! Von diesen Einkünften rechnet er 5.700.000 Taler als
Überschuß. den er für den Kriegsschatz, Festungsbauten,
Landesverbesserungen oder sonstige außergewöhnliche Ausgaben
verwenden konnte. Diese Summe ist wieder denkbar hoch gegriffen.
Denn 16 Millionen beanspruchte der regelmäßige Etat mindestens.
Das Heer kostete jährlich 13 Millionen, die Hofstaatskasse, was
wir heute Zivilliste nennen, erhielt 492.000. und die
Regieverwaltung verschlang 800.000 Taler, so daß für die ganze
übrige Staatsverwaltung nur rund 1.700.000 Taler übrigblieben,
eine fast unglaublich niedrige Summe, selbst wenn man die
miserable Besoldung der deutschen Beamten in gebührenden Anschlag
bringt. Auf keinen Fall hat Friedrich mehr als die von ihm selbst
angegebenen 5.700.000 Taler Überschuß gehabt. Dagegen ist seine
Angabe, daß er davon regelmäßig 2 Millionen in den Kriegsschatz
gelegt habe, nichts weniger als zweifelsfrei. Da er vor dem Jahre
1766 nicht wohl mit der Bildung eines neuen Schatze beginnen
konnte, so hätten bei seinem Tode 40 Millionen darin sein müssen;
alle sonstigen Berechnungen, soweit sie auch von 55 Millionen
(Krug und Riedel) bis 76 Millionen (Lombard) auseinandergchen.
stimmen darin übereinn, daß der König einen beträchtlich größeren
Schatz hinterlassen hat, als nach seiner eigenen Angabe hätte
erwartet werden dürfen. Lassen wir es indessen bei seinen 2
Millionen auf das Jahr bewenden!
Dann blieben ihm jährlich noch 3.700.000 Taler für
außergewöhnliche Ausgaben, auf 20 Jahre gerechnet also 74
Millionen Taler. Nun hat er in dieser Zeit rund 8 Millionen für
den Bau von Festungen, für Artillerie usw. verwandt; der
Bayerische Erbfolgekrieg kostete 29 Millionen; endlich zahlte
Friedrich 3 Millionen Subsidien an die Kaiserin Katharina für ihre
Türkenkriege. Das sind im ganzen 40 Millionen. Ferner aber hatte
der König, obgleich er persönlich aller höfischen Verschwendung
abgeneigt war und nach einer Versicherung seines Testaments für
seine Person nie mehr als 220.000 Taler jährlich verbrauchte, doch
einzelne sehr kostspielige Liebhabereien. In seinem Nachlasse
fanden sich 130 mit Brillanten und anderen kostbaren Steinen
besetzte Dosen, die einen Gesamtwert von gegen 1 1 /2 Millionen
darstellten. Viel schwerer noch fiel ins Gewicht, daß er in
reichlichem Maße die Bauwut aller Despoten teilte. Die eine
Tatsache, daß er gleich nach dem Kriege, mitten in dem
fürchterlichsten Elend des Landes, den ebenso kostspieligen wie
zwecklosen Bau des Neuen Palais in Potsdam begann, sollte ehrliche
Leute schon hindern, den Mund gar zu voll zu nehmen von seiner
"landesväterlichen Fürsorge". Nach Retzow kostete dieser Bau 11
Millionen und ebensoviel seine innere Ausstattung(2). Nehmen wir
indessen an, daß Retzow, der dem Könige nicht wohlgesinnt war, arg
übertrieben hat, so gibt doch ein unterrichteter und wohlgesinnter
Zeuge, ein Baumeister Friedrichs, die Summe dessen, was allein in
und bei Potsdam verbaut worden ist, auf mehr als 10 1/2 Millionen
an (3). Es mag nun ganz unberedinct bleiben, was Friedrich für
Bauten in Breslau. Königsberg. Berlin (die Bibliothek, die großen
Kirchen auf dem Gendarmenmarktc. mehrere Brückenkolonnaden u.a.
m.) aufgcwandt hat: Mangers 10 1/2. und die für die Dosen
verausgabten 1 1/2 Millionen ergeben weitere 12 Millionen, die von
den 74 Millionen abzuziehen sind, über die Friedrich in den
letzten zwanzig Jahren seiner Regierung für außergewöhnliche
Ausgaben verfügt hat. Es bleiben also für die Hebung des
Volkswohlstandes nur 22 Millionen übrig, und um überhaupt auf
Hertzbergs Ziffer zu kommen, muß man die gegen 2 1/2 Millionen
einrechnen, die Friedrich nach seiner Angabe gleich beim
Friedensschlüsse von Hubertusburg von den für den nächsten Feldzug
bereitliegenden Geldern für die notdürftigste Wiederherstellung
des Landes aufgewandt hat.
Es sei nochmals hervorgehoben, daß diese Ziffern keinen
absoluten Wert haben sollen. Um ein möglichst erschöpfendes und
zutreffendes Bild der friderizianischen Finanzwirtschaft zu geben,
wäre bei der verwickelten Kassenführung des Königs und den höchst
tendenziösen Darstellungen, die darüber veröffentlicht worden
sind, ein eigenes Buch notwendig. Für unsern Zweck, nämlich
festzustellen, welche Summe Friedrich günstigstenfalls für
Landesverbesserungen verbraucht haben kann, war es aber erlaubt,
auch mit ungewissen Ziffern zu rechnen, wenn wir unter den
abweichenden Angaben immer die höchsten für seine gesamten
Einkünfte und immer die niedrigsten für seine sonstigen Ausgaben
einstellten. Dies haben wir durchweg getan, auch wenn wir in einem
besonderen Falle es einmal nicht getan zu haben scheinen. So haben
wir uns nicht entschließen können, die etatmäßigen Heereskosten
Friedrichs von den 13 Millionen, die ältere und unbefangene
Schriftsteller mit großer Übereinstimmung angeben, auf die
12.100.978 Taler herabzusetzen, die ein neuerer Historiker
berechnet. Indessen dieser Historiker berechnet auch den
hinterlassenen Kriegsschatz des Königs auf 63 Millionen, während
wir dafür nach Friedrichs Angaben nur 40 Millionen angesetzt
haben. Ein leichtes Rechenexempel ergibt, daß wir somit die
Gesamtausgaben für Kriegsheer und Kriegsschatz noch immer
niedriger eingeschätzt haben als jener Historiker. Und so darf man
denn mit aller unter den obwaltenden Umständen erreichbaren
Sicherheit sagen, daß Friedrich nach dem Siebenjährigen Kriege für
die Bevölkerung des preußischen Staates an Geschenken, Erlassen,
Unterstützungen, Vergütungen und industriellen Unternehmungen im
günstigsten und leider nicht einmal wahrscheinlichen Falle die
rund 24 bis 25 Millionen Taler verbraucht hat, die Hertzberg
berechnet.
Die Summe selbst beträgt gerade den fünften Teil der
Brandschatzungen allein in barem Gelde, die das Land im Kriege an
die auswärtigen Feinde zu zahlen gehabt hatte. Das wäre nicht
viel, aber es wäre immerhin etwas. Leider verdunkelt die Art, wie
diese Summe auf die verschiedenen Klassen der Bevölkerung verwandt
wurde, gar sehr den Schein des patriarchalischen Wohllebens, den
sie etwa noch auszustrahlen scheint. Die Städte und die städtische
Industrie erhielten davon wenig genug, die Bauern noch viel
weniger, den Löwenanteil aber die Junker. Gegenüber den 25.000
Talern, die Friedrich den westfälischen Städten nach dem
Friedensschlüsse zum Wiederaufbau ihrer Häuser und Straßen
schenkte, oder selbst den 100.000 Talern, die Frankfurt a. d. O.,
die bedeutendste Handelsstadt der Mark, zu gleicher Zeit und zu
gleichem Zwecke erhielt, scheffeln gleich ganz anders die mehr als
21 1/2 Millionen, die allein für den Adel Pommerns und der
Neumark, zweier ungefähr den sechsten Teil des Staatsgebiets
umfassender Provinzen, nach dem Siebenjährigen Kriege aufgewandt
wurden, teils als Geschenke zur Bezahlung seiner Schulden, teils
als Meliorationskapitalien für seine Güter. Diese Kapitalien waren
unkündbar, und wenn sie mit 1 bis 2 Prozent verzinst werden
mußten, so waren „die Interessen" zu „Pensionen für arme
Offizierswittwen und vom Adel" bestimmt. Wir gehen indes auf diese
Verhältnisse nicht näher ein und verweilen lieber etwas
ausführlicher bei dem, was Friedrich für die große Masse der
arbeitenden Bevölkerung, nämlich für die Bauern, getan hat.
Einesteils fällt damit das schärfste Licht auf Friedrichs
„landesväterliche Fürsorge", andererseits sind wir gerade über
diese Frage durch eine ganz unanfechtbare Urkunde ausführlich
unterrichtet.
Einer der wenigen deutschen Beamten, die Friedrichs Vertrauen
bis an ihren Tod genossen, war, Johann Rembert Roden. Ein guter
Organisator, hatte er sich in dem Hauptquartiere des Herzogs
Ferdinand von Braunschweig ausgezeichnet und war von diesem nach
dem Kriege an den König empfohlen' worden. Friedrich benutzte ihn
vielfach bei der Wiederherstellung des Landes, übertrug ihm
namentlich auch die Organisation von Westpreußen nach der ersten
Teilung Polens im Jahre 1772, urid machte ihn dann zum Präsidenten
der Obcrrechenkammer. Als solcher erhielt Roden 1774 den Auftrag,
durch eine Reihe von Vorträgen den Thronfolger in die
Finanzverwaltung des preußischen Staates einzuweihen, und er
übergab dann zum Schlüsse seines Unterrichts dem Prinzen eine
„Kurzgefaßte Nachricht von dem Finanzwesen". Diese lehrreiche,
überall aktenmäßig begründete Urkunde ist glücklicherweise schon
durch den alten Preuß. der noch nicht wie die heutigen, mit dem
Zutritte zu den Archiven begnadigten Forscher vom Apfel der
Erkenntnis gegessen hatte, unverstümmelt ans Tageslicht gezogen
worden(4). Sie ist nicht frei von großen Lücken, denn Roden
gleitet über die Akziseverfassung mit wenigen Sätzen hinweg: das
Schicksal des Geheimen Finanzrates Ursinus mußte ihm warnend vor
Augen schweben. Um so ausführlicher und gründlicher handelt er von
der Kontributionsverfassung, d.'h. von der direkten Steuer, welche
die bäuerliche Bevölkerung aufzubringen hatte, und dabei wtrft er
Schlaglichter auf die Lage dieser Bevölkerung, die von,größtem
Interesse sind.
Die Kontribution war nach der Ertragsfähigkeit der einzelnen
Ländereien umgelegt, so zwar, daß sie einen bestimmten Teil dessen
betrug, was der Bauer für seinen eigenen Bedarf und für den
Verkauf erntete. Dieser bestimmte Teil war nicht in allen
Provinzen ganz gleich bemessen; in der Mark und in Westpreußen
belief er sich auf 33 1/3, in Schlesien auf 34, in Pommern
auf 42 1/2 Prozent, in anderen Landesteilen noch höher. Roden
erläutert die Art dieser Steuer an einem Bauern im Dorfe Tempelhof
bii Berlin, der von jeder Hufe zu 30 Magdeburgischen Morgen 8
Taler 3 Groschen Kontribution zu zahlen hatte (der Taler wurde
damals zu 24 Groschen berechnet: nach heutigem Gelde betrug der
Groschen also 12 1/2 Pfennig). Nun konnte der Bauer außer dem
eigenen Verbrauch aber nur 13 Scheffel von dem Ertrage der Hufe
verkaufen, welche, zu 18 Groschen gerechnet, ihm 9 Taler 18
Groschen eintrugen. Nach eingehender Darlegung dieser Verhältnisse
fährt Roden dann wörtlich fort:
Der Bauer behielte also von seinem Gewinnste auf einer Hufe,
nach Abzug der bezahlten Kontribution, nur 1 Taler,15 Groschen
übrig, wovon er seine übrigen Prästanda unmöglich leisten kann.
Diese sind:
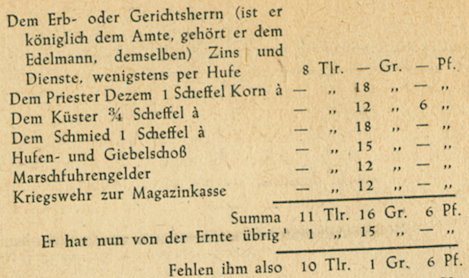
Ferner hat der Bauer zu prästiercn die Feuersozietätsgelder.
die Vorspannfuhren, die Bau- und Krepel-, auch Nachbarfuhrcn. die
Dorfauflagen und andere Vorfälle mehr, das Gesindelohn, da er
besonders Knechte wegen der vielen Hofedienste halten muß. so ihm
zur größten Last gereichen: zu welchem Ende er auch mehr Pferde
halten muß, weswegen die Einschränkung dieser Dienste eine
vortreffliche Sache wäre.
Wir unterbrechen hier Roden für einen Augenblick, um zu
bemerken, daß unter den „ändern Vorfällen mehr" sich auch noch
sehr drückende Lasten befanden: so die Grasung der
Kavalleriepferde aus den Wiesen der Dorfgemeinden während der
Monate Juni bis September, in denen der Reiter eine brutale
Herrschaft im Hause des Bauern führte; ferner für die anderen
Monate des Jahres die Lieferung der Fourage, die zwar zu einem
geringen Preise bezahlt, aber oft viele Meilen herangefahren und,
wenn sie ohne weitere Scherereien abgenommen werden sollte, mit
einem tüchtigen Überschuß zugunsten des Rittmeisters beladen sein
mußte, endlich auch der schon erwähnte indirekte Beitrag der
Bauern zur städtischen Akzise. Roden fährt dann fort:
Der Bauer würde, nach diesen angeführten Umständen, nicht
bestehen können, wenn er sich nicht auf eine andere Art
soutcnierte, z. B. daß er auf eine Hufe fast '* mehr aussäet, als
ihm zur Kontribution angeschlagen, daß er aus dfm Viehstand Geld
erwirbt und sich sonst durchzubringcn sucht. Aber er muß allen
Fleiß anwenden und sich kümmerlich behelfcn. wenn er sich ehrlich
ernähren und durch-biingen will, zumal wenn er sonst nichts
anderes, als sein eigenes Wohnhaus und Hofgebäude so er noch
Selbsten in Würden unterhalten muß. nebst dem dazu gehörigen Acker
im Vermögen hat. Er kann daher keine Unglücksfälle, als Mißwachs.
Hagelschaden, Mäusefraß. Überschwemmungen etc. übertragen, daferne
ihm nicht alsdann durch Remission unter die Arme gegriffen wird,
um ihn noch in etwas zu unterhalten. In ordinären Fällen wird ihm
aus der Kreiskasse geholfen, in extraordinären aber tritt der
Landesherr zu und läßt die Gelder bar an den Kreis übermachen,
oder auch Brod- und Saatkorn in natura geben.
Man sieht danach, was es mit den so viel gepriesenen
Steuererlassen, Geldvorschüssen. Kornlieferungen, wodurch
Friedrich angeblich den Bauernstand in die Höhe gebracht haben
soll, tatsächlich auf sich gehabt hat. Sie waren einzig dazu
bestimmt, den Bauer, ohne den freilich weder der König noch der
Junker leben konnte, auf der schmalen Grenze zwischen Hungerleben
und Hungertod zu erhalten. Von hier aus fällt denn auch das
richtige Licht auf die gleichfalls viel gepriesenen Kornmagazinc
Friedrichs, die ..Blüte friderizianischer Wirtschaftspolitik", in
der er „seinem Ideale dei allgemeinen Hausvaters am nächsten
komme", wie selbst ziemlich unbefangene Forscher sagen. Friedrich
verbot die Ausfuhr des Getreides, um seinen Preis möglichst
niedrig zu halten; in einer seiner Instruktionen an das
Generaldirektorium verlangt er, daß der Preis des Scheffels Roggen
immer zwischen 18 Groschen und einem Taler festgehalten werde. Das
geschah, um für sein Heer billiges Brot und für den Kriegsfall
gefüllte Magazine zu haben, aber wenn er diese Magazine nun auch
benutzte, um der bäuerlichen Bevölkerung Brot- und Saatkorn zu
liefern, sobald ihr Hungerleben durch irgendein unglückliches
Naturereignis in den Hungertod umzuschlagen drohte, so läßt sich
dieser „Sozialismus" am Ende noch mit gemäßigter Hochachtung
bewundern.
Man würde übrigens irren, wenn man in dem Bauern aus Tempelhof
bei Berlin, den Roden schildert, den elendesten Typus des
friderizianischen Bauern sehen wollte. In der Mark war der
Prozentsatz der Kontribution roch am niedrigsten bemessen; wo er,
wie in Friedrichs westfälischen Besitzungen, auf mehr als 50
Prozent stieg, verschlechterte sich entsprechend die Lage der
bäuerlichen Bevölkerung. Roden schreibt darüber:
Die Kontributionsprinzipia sind im Mindcnschen so angelegt,
daß zuvörderst die sämtlichen Ländcrcicn. Gärten und Wiesen
durch diverse vcreidcte Taxatoren nach dem jährlichen Ertrage
abgeschätzt sind: darnach ist die Kontribution dergestalt
ausgemittclt, daß von jedem Taler Ertrag jährlich an
Kontributionen 1) Gr. bezahlt wird. Die Hufe a 30 Morgen
Magdeburgisch kommt im Durchschnitt der Totalste auf 19 Taler, 5
Groschen, 1/2 Pfennig, obgleich viel schlecht Land vorhanden:
solchergestalt hat der Landmann noch 11 Gr. pro Taler übrig.
Davon soll er sich und seine Familie unterhalten. die
Haushaltung führen. Gesindelohn geben, dem Erb- oder Gutsherrn
sein Pacht zahlen und die übrigen Lasten tragen, so
schlechterdings unmöglich wäre, wenn der Bauer sich sonst nicht
durchzuhelfen suchte. Im Minden-und Ravensbergischen ist er mit
Frau, Kindern und Gesinde, sobald er nur vom Ackerbau eine Zeit,
oder gar nur Stunden übrig hat, zumal im Herbst bei den langen
Abenden und den Winter hindurch mit Garnspinnen zu Leinwand
beschäftigt und damit sucht er sich zu ernähren: sonst müßte er
davonlaufen, indem es dort viele Bauernhöfe gibt, die mehr
Abgaben haben, als die Höfe auch in den besten Jahren aufbringen
können.
So der kundigste Verwaltungsbeamte des friderizianischen
Staates in offiziellster Urkunde, in dem Berichte, durch den er
auf Befehl des Königs den Thronfolger in das Finanzwesen der
Monarchie einweihen sollte.
Wir wollen um der Gerechtigkeit willen aus Rodens Darstellung
nicht unerwähnt lassen, daß Friedrich wenigstens in den beiden von
ihm eroberten Provinzen, in Schlesien und Westpreußen, den Adel
zur Kontribution heranzog; hier standen ihm dfe Junker nicht mit
altercrbter Macht gegenüber, und er mußte sie wegen ihrer
Anhänglichkeit an Österreich und Polen scharf im Zügel halten.
Aber auch auf diesem verhältnismäßig lichtesten Gebiete der
friderizianisdien Steuerpolitik ist ihre Tendenz nicht, wie sie
selbst behauptete, Entlastung das Armen auf Kosten des Reichen,
sondern Belastung des Armen zugunsten des Reichen. So zahlte in
Westpreußen — unter fast durchgängigem Wegfalle der
Lehnpferdegelder — der evangelische Edelmann 20, der katholische —
Grundgedanke des Nathan? — 25. der Bauer aber 33 1/3 Prozent
Kontribution. Und ähnlich in Schlesien(5).
Stellt man nun aber jenen erdrückenden Belastungen der Bauern
die ängstliche Sorgfalt gegenüber, womit Friedrich im allgemeinen
die Steuerfreiheit des Adels beschützte, so kann man die edle
Dreistigkeit jener Hofgeschichtsschreiber bewundern, die von dem
„Bauernkönige" Friedrich schwatzen und die Hohenzollern durch
Beschützung des kleinen Mannes groß werden lassen, so kann man den
herrlichen Wert jener „Schulreform ' ermessen, die nach diesem
Leitmotive den Geschichtsunterricht an den deutschen Schulen
klittern will. Da sollten wir „gemütvollen" und „tiefsinnigen"
Deutschen uns doch nur ja vor den „leichtfertigen" und
„oberflächlichen" Franzosen verkriechen! Denen konnte Marx schon
im Jahre 1869 nachrühmen, daß sie der napoleonischcn Legende mit
allen Waffen der Forschung, der Kritik, der Satire, des Witzes den
Garaus gemacht haben, und was ist die napoleonische Legende doch
für ein ander Ding als die friderizianische! Der napoleonische
Staat besteht in allem Wesentlichen, in der Heeresverfassung, in
der inneren Verwaltung, im Finanz-, Justiz-, Unterrichtswesen noch
fort, wie der erste Konsul ihn im Jahre 1804 begründet hat —
natürlich nicht als Großer Mann, sondern als Erbe des Konvents —,
und eine bürgerliche Verfassung, die drei Dynastien, drei
Invasionen und selbst drei Revolutionen überstanden hat, kann denn
doch eher schon zum Heroenkultus des Mannes führen, auf dessen
Namen sie nun einmal getauft ist. Aber der friderizianische Staat,
der bei Jena in tausend Stücke zerschmettert wurde unter der
stürmischen Zustimmung der bürgerlichen und arbeitenden Klassen,
die in ihm zu leben verurteilt waren, und eine feudal-militärische
Verfassung, deren wüste Trümmer wie ein betäubender Alp auf allem
gesunden Leben der Gegenwart lasten, dürfen sich immer noch, ja,
je länger, je unbeschämter in einer Legende spiegeln, deren
schüchterne Kritik im Reiche der Gottesfurcht und frommen Sitte
schon als Hochverrat und Majestätsverbrechen gilt.
Friedrich selbst darf natürlich dafür nicht verantwortlich
gemacht werden. Er ist ganz unschuldig an der kecksten Unwahrheit
dieses Jahrhunderts, dem sogenannten „sozialen Königtum", und er
würde den Humbug nicht einmal verstehen, wenn er se.tne
wohlgesinnten Geschichtsschreiber von heilte lesen könnte. Was ihm
als „monarchische Sozialpolitik" angerechnet wird, war einzig
durch militärpolitische Gesichtspunkte bestimmt. An sich zwar
gehörte es zu den Aufgaben des absoluten Königtums, die
Leibeigenschaft der Bauern zu beseitigen, nicht aus Humanität, die
ihm ganz fremd war und auch ganz fremd sein mußte, sondern aus
fürstlichem Klassenintcresse. Die Leibeigenschaft stand wie eine
Mauer zwischen dem Despoten und der Mehrheit der Bevölkerung:
solange sie währte, hatte der Junker über die Bauern zu verfügen,
und der König höchstens insoweit, als es ihm der Junker
gestattete. Wir haben gesehen, wie sich seit der Entwicklung des
stehenden Heeres dieser Interessengegensatz zwischen dem Könige
und dem Junkertum bildete und verschärfte; schon die beiden ersten
preußischen Könige rüttelten an der Leibeigenschaft und namentlich
Friedrich Wilhelm
I. erklärte,
„was es denn vor eine edle Sache sei, wenn die Untertanen statt
der Leibeigenschaft sich der Freiheit rühmen". Er war denn
freilich auch wohl ehrlich genug, den Kabinettsordres, worin er
den Behörden die „Konservation" der „Untertanen" empfahl, die
Worte hinzuzufügen: „Damit der Landesherr seine Steuern erhalte",
was bei der höchst merkwürdigen Ausbildung der alten deutschen
Spräche im neuen Deutschen Reiche heute zu lesen ist: „Soziales
Königtum der Hohenzollern". Friedrich selbst spricht in seinen
Schriften mit lebhaftem Abscheu von der Leibeigenschaft als einem
„barbarischen Gebrauch", einer „abscheulichen Einrichtung", aber
er bekennt auch offen, daß es nicht in seinem guten Willen liege,
damit aufzuräumen. Daraus läßt sich ihm gewiß kein Vorwurf machen.
*Er konnte wirklich nicht, auch wenn er wollte, die
Leibeigenschaft abschaffen. Sie war die ökonomische Zelle der
Gesellschaft, deren politischer Repräsentant der preußische
Militärstaat war, und der ..erste Diener" dieses Staats konnte ihr
ebenso wenig anhaben als etwa die Zinne eines Turms auf den
verwegenen Einfalt geraten kann, die Mauer umzustürzen, worauf sie
ruht.
Ergibt sich diese Auffassung von selbst aus der ganzen Lage, so
fügt es sich glücklich, daß sie sich sogar urkundlich bestätigen
läßt. Einmal nämlich siegte der despotische Größenwahn über
Friedrichs nüchternen Sinn, und am 23. Mai 1763 dekretierte er von
Kolberg aus: „Sollen absolut, und ohne das geringste Raisonniren,
alle Leibeigenschaften, sowohl in Königlichen, Adligen, als
Stadtcigcnthumsdörfern. von Stund an gänzlich abgeschafft werden,
und alle diejenigen, so sich dagegen opponiren würden, so weit
möglich mit Güte, in deren Entstehung aber mit force dahin
gebracht werden, daß diese von Sr. K. M. festgesetzte Idee zum
Nutzen der ganzen Provinz ins Werk gerichtet werde." Darauf
versammelten sich am 29. Juni die vorpommerschen Landstände in
Demmin und richteten eine Promemoria an den König, worin sie sich
halb als gekränkte Unschuld und verkannte Wohltäter der Bauern
aufspielten, halb aber mit „Depeuplierung des Landes und Desertion
vom Militär" drohten, „weil kein Bauer im Stande ist, den Hof, das
Zuchtvieh und Ackergerät zu bezahlen, keiner aber auf den Fall, es
ihm umsonst zu lassen schuldig, folglich ein jeder sich
anderswohin zu begeben bedacht sein würde". So dummdreist diese
Drohung war — denn der Junker hatte gar kein Recht auf den Hof des
Bauern, und wa« half ihm der Hof, wenn kein Bauer da war, ihn zu
bewirtschaften? —, so genügte sie doch vollkommen, den König
lahmzulegen. Weder Gewalt, noch Recht konnten ihm helfen, denn das
Heer befehligten die Junker und in Gerichtshöfen sprachen sie
Recht. Er gab also klein bei. so sehr es sonst unter seinen
Grundsätzen obenan stand, um seiner despotischen Unfehlbarkeit
willen niemals einen Befehl zurückzunehmen.
So mußte sich Friedrich denn daiauf beschränken, in einem
fortdauernden Kleinkriege seine militärpolitischen Interessen
möglichst gegenüber dem gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse zu
wahren. Es gibt eine große Anzahl von Kabinettsordres, worin, er
diesem Ziele nachstrebt. Er kämpfte gegen das Bauernlegen, die
„Abmeierung der Bauern", und bemühte sich, den Bauern das
Eigentums- und Erbrecht an ihren Schollen zif sichern. Man kann
sogar anerkennen, daß er in dieser Beziehung weiter blickte als
der heutige Militärstaat. Wenn dieser in erstaunlicher Seelenruhe
es ruhig mit ansieht, wie in weiten Fabrikdistrikten die Masse der
arbeitenden Bevölkerung verkrüppelt, so eiferte Friedrich sehr
häufig gegen die gesundheitsschädlichen Mißhandlungen der Bauern
durch die Junker und die Domänenpächter. Wenn der heutige
Militärstaat sich hartnäckig weigert, die unmäßige Arbeitszeit
durch einen gesetzlichen Normalarbeitstag zu beschränken, weil er
in seiner überstiegenen Weisheit davon eine Schädigung der
Industrie befürchtet, so war sich Friedrich schon im Jahre 1748
darüber klar, wie er in einer Instruktion an das
Generaldirektorium sagte, daß „bei den schweren und ganz
unerträglichen Diensten echrentheils vor den Gutsherrn wenig
Nutzen, vor den Bauersmann aber sein gänzlicher Verderb
augenscheinlich herauskommt". Der König verlangt deshalb eine
„serieuse Untersuchung, ob nicht sowohl Amts- als auch Städte- und
adlige Untertha-. nen von diesem, dem Bauer so gar ruineusen
Umstände in gewisse Maße befreiet und die Sache dergestalt
eingerichtet werden könne, daß anstatt daß der Bauer jetzo die
ganze Woche hindurch dienen muß, derselbe die Woche über nicht
mehr als drei oder vier Tage zu Hofe dienen dürfe. Es wird dieses
zwar Anfangs etwas Geschrei geben, allein da es vor dem gemeinen
Mann nicht auszustehen ist. wenn er wöchentlich fünf Tage oder gar
sechs Tage dienen soll, die Arbeit an sich auch bei denen elenden
Umständen, worin er dadurch gesetzt wird, von ihm sehr schlecht
verrichtet werden muß, so muß darunter einmal durchgegriffen
werden, und werden alle vernünftigen Gutsherrn sich hoffentlich
wohl accomodiren, in diese Veränderung derer Dicnsttage ohne
Schwierigkeit zu willigen, um so mehr, da sie in der That ersehen
werden, daß wenn der Bauer sich nur erst ein wenig wieder erholt
hat, er in denen wenigen Tagen ebenso viel, und vielleicht noch
mehr und besser arbeiten wird, als er vorhin in denen vielen Tagen
gethan hat." Eine hausbackene, aber treffliche Wahrheit, die der
„geniale" Herr Bismarck bekanntlich nie begreifen konnte, und die
der neue Kurs im Deutschen Reiche bekanntlich auch noch immer
nicht begreifen zu können scheint.
Wie vernünftig nun aber diese und ähnliche Instruktionen
Friedrichs nicht nur klingen, sondern auch sind, so darf man dabei
doch mehrerlei nicht übersehen. Erstens daß der König nicht für
den Bauer gegen den Junker, sondern gegen den
Junker um den Bauer kämpft. Er wollte eine andere
Verteilung des aus dem Bauern gezapften Mehrwerts, eine für ihn
günstigere und deshalb für das Junkertum ungünstigere, aber wenn
der Proletarier etwa seinen Lohn auf Kosten des Mehrwerts zu
steigern gedachte, so war Friedrich immer auf Seite der möglichst
erschöpfenden Ausbeutung. So bedrohte er in der Gesindeordnung
sowohl die Empfänger als unter Umständen auch die Geber eines" die
Taxe überschreitenden Lohns mit Zuchthausstrafe, wogegen „es sich
von selbst versteht", daß ein unter der Taxe bleibender Lohn
erlaubt ist. Und wenn gar die Bauern unruhig wurden über die
..unerträglichen Dienste" und „ruineusen Umstände", dann wußte
Friedrich auch nichts anderes, als was Große Männer unter solchen
Umständen immer nur wissen, also was Luther im sechzehnten und
Bismarck im neunzehnten Jahrhundert wußte. Als ein Jahr vor
Friedrichs Tode die schlesischen Arbeiter zu murren begannen,
schrieb der König an den schlesischen Provinzialminister v. Hoym:
„Das Mehrste zur Beruhigung der Leute wird beitragen, da sie doch
im Gebirge meistens evangelisch sind, wenn die Prediger ihnen
zureden und alles ordentlich erklären ... sodann müssen auch die
Schulzen, besonders da im Gebirge, scharf vigiliren, wenn sich
etwa fremdes Gesindel sehen läßt, das Zusammenkünfte hält und dem
gemeinen Volk allerhand Dinge in den Kopf setzt; diese müssen sie
auf der Spur verfolgen und sobald sie den geringsten Unrath
merken, sie sogleich bei den Ohren nehmen und an die Gerichte
abliefern." Die Ordre ist, wie gesagt, im Jahre 1785 erlassen.
Sonst könnte man fast meinen, sie stamme aus dem. Jahre 1878, wo
auch erst die Religion dem Volke erhalten werden sollte und dann
das Sozialistengesetz auf dem Fuße hinterdrein marschiert kam.
Zweitens aber hat Friedrich mit jenem Kleinkriege nicht viel
erreicht. Am ehesten noch etwas in den beiden eroberten Provinzen
Schlesien und Westpreußen, wo der König leichteres Spiel mit den
Junkern hatte. So zwang er die schlesischen Grundherren zur
Wiederherstellung der bäuerlichen Hütten und Scheunen, zur
Ausstattung der Bauerngüter mit Vieh und Gerät. Aber sein eigenes
Interesse, die Sorge um seine Kassen und seine Rekruten, war auch
hier die Grenze, die er nicht überschritt. Zudem liegt auf der
Hand, wie wenig damit gesagt, geschweige denn getan war. wenn er
den schlesischen Bauern das Recht gewährte, sich über strenge
körperliche Züchtigung bei den Regierungen zu beschweren, oder
wenn er in Westpreußen die „polnische Sklaverei", den »harten,
polnischen Fuß" auf die „preußische Landesart" gemildert wissen
wollte. Die ehrlicheren bürgerlichen Historiker machen denn auch
kein Hehl aus der Erfolglosigkeit dieser Bemühungen. ,,Die alten
Verhältnisse blieben... Bei dem allen blieb der Landmann gebunden,
scholleigen der Masse nach" (Preuß); „praktisch hat dies alles
fast gar keine Frucht getragen: nicht einmal auf den Domänen, wo
der Erfolg doch so leicht gewesen wäre" (Röscher). Als der König
vierzehn Tage vor seinem Tode bei dem Kammerpräsidenten von
Königs-' berg anfragte, ob „nicht alle Bauern in Meinen Acmtern
aus der Leibeigenschaft" gesetzt werden können, schrieb er selbst
das treffendste Urteil über seine Bauernpolitik.
Drittens und letztens aber — selbst wenn man Friedrichs
angebliche Verdienste um die Bauernbefreiung so hoch schätzen
wollte wie die preußischen Byzantiner, so würden diese Verdienste
dennoch mehr als aufgewogen durch Friedrichs
Gemeinteilungsgesetze, die Aufteilung der Gemeinweiden, die
seltsamerweise auch von den besseren, bürgerlichen Historikern, so
von Freytag und Röscher, als eine Art sozialer Reform aufgefaßt
werden, tatsächlich aber nach einem Worte von Rudolf Meyer darauf
hinausliefen, daß die Gemeinweiden „meist den großen Gütern
zugeschlagen und damit die kleinen Leute, wenn auch teilweise
gegen Entschädigung, der freien Viehweide beraubt, teilweise
proletarisiert und somit für den Gutsgesindedienst adaptiert
wurden". Dies „eifrige Wegräumen aller solchen Beschränkungen des
freien Grundeigentums, die mit dem mittelalterlichen Gemeindewesen
zusammenhängen", lief in der Tat auf die Proletarisierung der
bäuerlichen Bevölkerung hinaus, und wenn Röscher darin die helle
Seite des „Janus-kopfet' sieht, den Friedrichs agrarische
Sozialpolitik biete, so mag man sich nicht leicht einen zu dunklen
Begriff von dessen dunkler Seite machen (6).
Unter solchen Umständen ist der Verfall des preußischen
Ackerbaus unter Friedrich, den sogar die patriotischen
Geschichtsschreiber anerkennen, leicht zu erklären — trotz der
reichen Geldspenden, die er für die ..notleidende Landwirtschaft",
will sagen die Junker, stets bei der Hand hatte, und auch trotz
seiner so viel gepriesenen „Kolonisationen". An sich waren seine
Landesmeliorationen, die Verwallung der Netze und der Warthe, die
Urbarmachung des Drömlings und des Oderbruchs sowie vieler
kleinerer Sumpfstrecken in Pommern, in der Mark, im
Magdeburgischen, gewiß der beste Teil seiner Wirtschaftspolitik
und wohl mochte der König mit berechtigtem Selbstgefühl sagen,
hier habe er im Frieden eine neue Provinz erobert. Allein es ist
eine tragikomische Entstellung der Sachlage, wenn dabei seine
Bewunderer in seine Seele das faustische Sehnen dichten, auf
freiem Grund mit freiem Volk zu stehen. Da klingt es viel
prosaischer, ist aber viel richtiger, wenn Roden schreibt: ,,Sr.
K. M. allergnädigste Intention gehet dahin, daß. wenn bei den
Städten, oder denen von Adel wüste Gründe und Brücher vorhanden,
diese aber nicht im Stande wären, solche urbar zu machen, alsdann
der Landesherr zutreten, solche auf Höchstdero Kosten urbar
machen, Häuser bauen und solche mit Familien besetzen lassen
müßte: die Revenuen blieben zwar der Stadt und dem von Adel, das
Land würde aber doch dadurch immer mehr und mehr peuplieret und
per indirectum profitierten doch die Königlichen Kassen und der
Staat davon." Den Hauptvorteil zog „der von Adel", denn gegen den
adligen Landbesitz war der städtische kaum zu rechnen. Mit der
Ansetzung der Kolonisten hatte der König wenig
Glück. Er nahm dazu nicht etwa die jüngeren Söhne der heimischen
Bauern, wie schon zeitgenössische Schriftsteller rieten, sondern
suchte in der einseitigen Bevölkerungspolitik seines
Merkantilismus möglichst viel fremdes Volk ins Land zu ziehen. Da
aber sein Despotismus im Reiche und im Auslande durchaus keines
einladenden Rufes genoß. so mußte er den Einwanderern die größten
Vorrechte in Sachen der bäuerlichen, militärischen und
steuerlichen Lasten versprechen, ohne doch viel anderes zu
bekommen, als verlorenes Gesindel. Statt wirklicher Bauern kamen,
wie er einmal sagt, „Perruquiers und Commedianten" oder, wie er
ein andermal klagt, „Barbiere, Destillateure. Viktualienhändler,
Apotheker. Köche, Kuchenbäcker, Glücksbudner"; ein drittes Mal
suchte er gar die türkischen Tataren anzulocken unter dem
Versprechen, ihnen Moscheen zu bauen. Über die Kolonien in
Ostfriesland schreibt der alte Schlosser: "Gesinde! aller Art
strömte herbei, der Verfasser dieser Schrift selbst hat gesehen,
wie unsicher dadurch die an sich unzugänglichen Gegenden wurden,
wie des kargen Königs Geld dabei verschwendet ward und wie die
Bewohner seiner kostspieligen Anlagen schon nach zwanzig Jahren
durch Elend, Trägheit, Schmutz, Bettelei, Raub und Mord ein
Schrecken der alten Einwohner geworden waren." Die 300.000
Kolonisten, die Friedrich angesetzt haben soll, waren also eine
sehr zweifelhafte Vermehrung der Bevölkerung, und der an sich
wohlgemeinte Versuch des Königs, die durch die Leibeigenschaft
„faule und schläfrige Art des Landmanns durch neues Blut zu
korrigiren und dem Lande ein Exempel besserer Wirtschaft zu
geben", verdient nicht ganz die Lobeshymnen der patriotischen
Historiker.
Anmerkungen
1) Schmoller. Die
preußische Seidenindustrie im achtzehnten Jahrhundert, 35.
2) Retzow. Charakteristik der widnigsten Ereignisse des
Siebenjährigen Krieges 2. 455.
3) Manger. Baugeschichte von Potsdam 3. 825.
4) Preuß
4. 415 ff.
5) In
einer Anmerkung des Kapitals l. S. 762 erwähnt Marx die elende
Lage des friderizianisdien Bauern unter Anziehung einiger Sätze
von Mirabeau. wofür er von preußischen Historikern der
tendenziösen Darstellung geziehen worden ist. Wir haben aus schon
angeführten Gründen das Werk von Mirabeau-Mauvillon ganz
beiseitegelassen, möchten aber bemerken, daß die von Marx
beiläufig angezogenen Sätze Mirabeaus ein nicht so krasses Bild
der Sachlage geben, wie der amtliche Bericht von Roden. Überhaupt
tun die wenigen Worte, die Marx im Vorbeigehen dem
friderizianischen "Regierungsmischmasch von Despotismus,
Bureaukratie und Feudalismus" widmet, diesem seltsamen Gebilde
eher zu wenig, als zu viel. Wenn beispielsweise Marx sagt
Friedrich habe in den meisten Provinzen Preußens den Bauern
Eigentumsrecht gesichert, so gilt das tatsächlich nur von den
Domänenbauern. Am 20. Februar 1777 verfügte Friedrich, "daß an
allen Orten, wo es noch nicht geschehen, die unter die Ämter
gehörigen Bauerngüter den Untertanen erb- und eigentümlich
übergeben werden". Siehe die Ordre bei Preuß 4, 466 f.
6) Siehe Rudolf Meyer. Das nahende Ende des landwirtschaftlichen
Großbetriebs, in der Neuen Zeit 11.1.
304. Ferner Röscher 399. Sonst Ist Röscher»
Darstellung der fridcrizianischcn Sozialpolitik in der
bürgerlichen Gcschichtsliteratur wohl noch'die unbefangenste. Für
die Einzelheiten sind die Kabincttsordres des Königs und teilweise
auch seine Schriften einzusehen, dann aber auch die altere
preußische Geschichtsschreibung etwa bis zum Jahre 1848. Die
neuere Literatur, namentlich soweit sie aus Archiven schöpft, ist
nicht wertlos, doch müssen diese Bücher wie Palimpsestc behandelt
werden. Man muß zunächst die frommen Lobgesänge auf den
friderizianischen .,Sozialismus" beseitigen und dann untersuchen,
was sidi von dem verkratzten und verwischten Urtext noch
entziffern läßt. Natürlich gibt es auch vortreffliche Ausnahmen:
so Knapp, Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter In
den Siteren Teilen Preußens, wo in der Einleitung bemerkenswerte
Einzelheiten über die Erfolglosigkeit der friderizianischcn
Bjucrn-politik gegeben sind.
Editorische Hinweise
*) Die Teilüberschriften stammen nicht
vom Autor.
Franz Mehring: Friedrichs aufgeklärter
Despotismus,entnommen aus: derselbe, Historische Aufsätze zur
preußisch-deutschen Geschichte, 2. Auflage, Berlin 1946, S.
74-90
OCR-Scan: red. trend
|