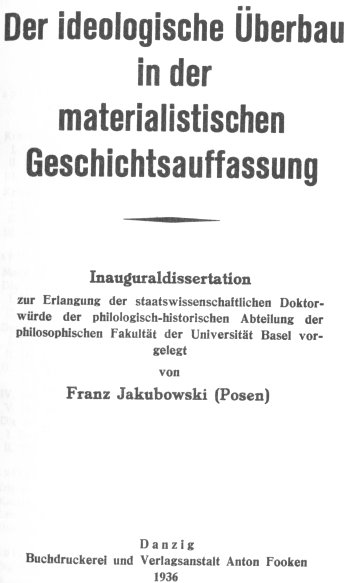I.
Der Begriff der Ideologie
„Die
Ideologie", schreibt Friedrich Engels (38), „ist ein
Prozeß, der zwar mit Bewußtsein vom sogenannten Denker
vollzogen wird, aber mit einem falschen Bewußtsein." Mit
diesen Worten kennzeichnet Engels den Ausgangspunkt für
das Problem der Ideologie. Ideologie heißt zunächst ein
falsches Bewußtsein, das mit der Wirklichkeit nicht in
Einklang steht, sie nicht adäquat trifft und ausdrückt.
Hier erhebt sich die Frage, was denn eigentlich diese
Wirklichkeit ist, oder genauer, was die materialistische
Geschichtsauffassung unter „Wirklichkeit" versteht.
Bevor diese Frage beantwortet wird, ist es notwendig,
den marxistischen Ideologiebegriff als „totalen" zu
kennzeichnen. Bei der Entwicklung des Ideologiebegriffs
und im Verlauf der Darstellung, wie der Verdacht der
Ideologiehaftigkeit des Denkens sich immer mehr
erweiterte, unterscheidet Karl Mannheim (39) einen
partikularen und einen totalen Ideologiebegriff. In
beiden Fällen werden Ideen des Gegners als falsch
erklärt, aber nicht durch eine direkte, verstehende
Versenkung in das Gesagte zu erfassen gesucht, sondern
auf dem Umweg des Verstehens des Trägers dieser Ideen;
die Seinslage des Trägers wird als Grund für die
Falschheit der betreffenden Vorstellungen aufgefaßt. Der
partikulare Ideologiebegriff untersucht nur einen Teil
der Vorstellungen des Gegners und depraviert ihren
Inhalt als Ideologie; dabei steht der Untersuchende noch
auf der gleichen theoretischen Basis wie sein Gegner,
versucht dessen Ideen psychologisch zu erklären und
bedient sich dabei hauptsächlich einer
Interessenpsychologie. Die Falschheit der gegnerischen
Anschauungen wird aus bestimmten Interessen erklärt, die
zur Lüge oder zur — bewußten oder unbewußten Verhüllung
eines Tatbestandes zwingen. Der totale Ideologiebegriff
hingegen stellt die gesamte Weltanschauung des Gegners
einschließlich der kategorialen Apparatur in Frage. Hier
wird infolgedessen nicht nur im psychologischen Bereich
auf den Ideenträger und dessen Lage im sozialen Raum
„funktionalisiert", sondern die gesamte Vorstellungswelt
wird auf die Seinslage des Trägers bezogen. Der totale
Ideologiebegriff sucht daher die objektiven
Strukturzusammenhänge zu entdecken, denen der gesamte
gegnerische Standpunkt, seine Betrachtungsweise
entspricht(40).
Der Ideologiebegriff des historischen Materialismus
ist der totale. Das Bewußtsein ist bewußtes Sein und
wird vom gesellschaftlichen Sein bestimmt. Ein falsches
Bewußtsein muß also einer bestimmten Lage im sozialen
Sinn entsprechen, einem gesellschaftlichen Standort, der
eine richtige Erkenntnis nicht zuläßt. Andererseits sind
die betreffenden Vorstellungen doch insofern „richtig",
als sie der adäquate Ausdruck eben dieses Standortes
sind. Damit ändert sich der Charakter des
Ideologiebegriffs, die objektive Falschheit des
Bewußtseins äußert sich nun als Par-tikularität. Jedem
sozialen Standort entspricht eine besondere Art der
Sicht, der Ideologie. Und da ohne genauere Analyse jeder
soziale Standort in der bürgerlichen Gesellschaft
partikular erscheint, so muß jedes Wissen und Denken,
das einem dieser Standorte entspricht, als Ideologie
gelten. Solange man auf die einzelnen gesellschaftlichen
Standorte nicht näher eingeht, müssen die ihnen
entsprechenden Ideologien als prinzipiell gleichwertig
anerkannt werden. Jeder der partikularen Standpunkte ist
fähig, Gebiete zu erhellen, die den anderen Standpunkten
verborgn blieben; die einzelnen Teilaspekte ergänzen
einander(41).
„Die materialistische Geschichtsdeutung ist kein
beliebig zu besteigender Fiaker und macht auch vor den
Trägern der Revolution nicht Halt", schreibt Max
Weber(42), und so fordert Mannheim mit Recht, die
Methode des historischen Materialismus auch auf ihn
selbst anzuwenden(43). Der historische Materialismus
wird nun selbst zu einer Ideologie, die einem
partikularen sozialen Standort entspricht, zur Ideologie
des Proletariats. So führt nach Mannheim die allgemeine
Fassung des totalen Ideologiebegriffs zum
„Relationismus", d. h. zu einer Wissenssoziologie, die
sich mit der Seinsgebundenheit des Denkens
beschäftigt(44). Jeder historische und soziale Standort
erscheint nun als partikular(45).
An diesem Punkte entsteht eine Schwierigkeit, wenn
die einzelnen Bewußtseinsstrukturen auf ihre
„Richtigkeit" hin untersucht werden, bewertet werden
sollen. Falsch und ideologisch ist nach Mannheim „ein
Bewußtsein, das in seiner Orientierungsart die neue
Wirklichkeit nicht eingeholt hat und sie deshalb mit
überholten Kategorien eigentlich verdeckt" oder als
„utopisches" Bewußtsein das Sein überholt hat (46). Die
Wirklichkeit wird, wie schon aus dieser Definition
hervorgeht, als dynamisch, historisch-sozial
veränderlich aufgefaßt. Praktisch führt diese sehr
allgemeine Formel dazu, einer ganzen Reihe von
partikularen Standpunkten eine teilweise, nicht nur
subjektive Richtigkeit zuzusprechen. Und so gelangt
Mannheim bei der Anwendung seiner Theorie auf das
Problem des Verhältnisses von Theorie und Praxis dazu,
allen behandelten Strömungen (Konservativismus,
liberal-demokratisches Bürgertum, Sozialismus,
Fascismus) eine gewisse Richtigkeit zuzubilligen, ohne
einen dieser Standpunkte ganz anzunehmen. „Wir fanden",
so schreibt er( 47), „daß die verschiedensten
Parteiungen stets nur bestimmten Bestandteilen und
Gebieten der historisch-politischen Wirklichkeit
gegenüber hellsichtig wurden." Und gerade an dem
behandelten Problem lasse sich „der gegenseitige
Ergänzungscharakter der sozial und politisch gebundenen
Partikularerkenntnisse" besonders klar aufweisen.
An diesem Ergebnis zeigt sich bereits, wie weit
Mannheim sich vom historischen Materialismus entfernt
hat, für den ein solches Resultat undenkbar ist. In der
Tat ist die scheinbar so konsequente Interpretation,
Anwendung und Fortführung des Grundgedankens des
historischen Materialismus durch Mannheim in
Wirklichkeit inkonsequent. Mannheims Fehler besteht vor
allem darin, daß er die einzelnen sozialen Standorte,
ohne sie zu analysieren, als prinzipiell
gleichberechtigt ansieht. Der historische Materialismus
dagegen untersucht die einzelnen Positionen in der
Gesellschaft, die Klassen, auf die Möglichkeit eines
richtigen Bewußtseins aus ihrer Seinslage hin. Und er
kommt dabei zu der Erkenntnis, daß das Proletariat sich
von den anderen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft
wesensmäßig insofern unterscheidet, als es bereits
selbst eine — negative — Totalität ist, gewissermaßen
eine Gesellschaft außerhalb der bürgerlichen
Gesellschaft (48). Daher ist sein Standpunkt nicht mehr
partikular, sein Bewußtsein nicht mehr ideologisch. Der
ideologische Charakter des Bewußtseins der anderen
gesellschaftlichen Klassen und Schichten kann durch die
Beziehung der Vorstellungen zur Wirklichkeit
nachgewiesen werden. Dieser konkrete Nachweis ist aber
nur dadurch möglich, daß der Begriff der Wirklichkeit —
der von dem Mannheimschen Begriff nicht
wesensverschieden ist — mit Hilfe der Dialektik genauer
bestimmt wird als bei ihm. Es muß nun also die Frage
geklärt werden, was die materialistische
Geschichtsauffassung unter „Wirklichkeit" versteht.
II.
Die konkrete Totalität als
Wirklichkeitskategorie
Wirklichkeit ist vor allem nicht das, was dem
„gesunden Menschenverstand", jenem „ärgsten
Metaphysiker" (Engels), als besonders wirklich
erscheint: die sogenannten Tatsachen an der Oberfläche
der bürgerlichen Gesellschaft, die Dinge in ihrer
Vereinzelung, wie sie im Kapitalismus erscheinen.
Erscheinungsform und Wesen der Dinge fallen nicht
unmittelbar zusammen. „Die fertige Gestalt der
ökonomischen Verhältnisse, wie sie sich auf der
Oberfläche zeigt", schreibt Marx(49), „in ihrer realen
Existenz, und daher auch in den Vorstellungen, worin die
Träger und Agenten dieser Verhältnisse sich über
dieselben klar zu werden suchen, sind sehr verschieden
von und in der Tat verkehrt, gegensätzlich zu ihrer
inneren, wesentlichen, aber verhüllten Kerngestalt und
dem ihr entsprechenden Begriff." Die scheinbaren
Tatsachen der Oberfläche sind Produkte des dinglichen
Scheins der kapitalistischen Produktionsweise. Um die
Wirklichkeit zu erkennen, ist es also nötig, diese
dingliche Hülle zu zerreißen und zu der inneren
Kerngestalt dieser Verhältnisse vorzustoßen, sie von
ihrer Oberflächenexistenz zu unterscheiden und
andererseits diese Erscheinungsformen als notwendige
Formen aufzuweisen, in denen das Wesen, die Kerngestalt
auftritt. Die Aufzeigung und Erklärung der
Verdinglichung gibt die Möglichkeit, durch den Schein
zum Wesen vorzudringen. Es ist also notwendig, die
Kategorien, die Methode zu zeigen, vermittelst derer man
die Wirklichkeit im Ganzen, als Kerngestalt und als
reale Existenz der Oberfläche erfassen kann.
Es wird zunächst nötig, die Wirklichkeit nicht als
einen „Komplex von fertigen Dingen" zu fassen, „sondern
als einen Komplex von Prozessen, worin die scheinbar
stabilen Dinge nicht minder wie ... die Begriffe eine
ununterbrochene Veränderung des Werdens und Vergehens
durchmachen"(50). Die Wirklichkeit wird also nun in
ihrer geschichtlichen Veränderung gesehen, das Sein wird
zum Werden. Das gibt die Möglichkeit, die Begriffe, mit
denen diese Wirklichkeit ausgedrückt wird, konkret zu
fassen, während sie bei ungeschichtlicher
Betrachtungsweise einen abstrakt allgemeinen Charakter
tragen. So schreibt Marx über den Begriff
„Produktion"(51): „Wenn also von Produktion die Rede
ist, ist immer die Rede von Produktion auf einer
bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsstufe . . ."
„Die Produktion im allgemeinen ist eine Abstraktion,
aber eine verständige Abstraktion, sofern sie wirklich
das Gemeinsame hervorhebt, fixiert und uns daher die
Wiederholung erspart." Es ist notwendig, die allen
Produktionsstufen gemeinsamen Züge von den besonderen
jeder Epoche zu sondern. Der Fehler der „Vulgärökonomie"
liegt in dem Vergessen dieser Unterscheidung, und so
werden bei ihr die Erscheinungen des Kapitalismus zu
„natürlichen", ewigen. Durch die historisch-konkrete
Betrachtungsweise gelangt Marx dazu, den
allgemein-philosophi-schen Begriff „Bürgerliche
Gesellschaft", den er bei Hegel findet, kritisch
umzuwälzen und ihn konkret als die geschichtlich
gewordene und vergängliche bürgerliche Gesellschaft des
Kapitalismus aufzufassen(52). Die Betrachtung der
Tatsachen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, die
Verwandlung der Dinge in Prozesse bildet die erste
Durchbrechung des dinghaften Scheins der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung.
Die historische Erkenntnis der gesellschaftlichen
Beziehungen, der Wirklichkeit, ist aber nur dann
möglich, wenn die Tatsachen aus ihrer Isoliertheit
herausgehoben werden, in der sie der oberflächlichen
Betrachtung erscheint. Denn nur die Einzelkategorie kann
— in dieser Isoliertheit — als in der ganzen
gesellschaftlichen Entwicklung immer vorhanden gedacht
und behandelt werden(53). Um diesen übergeschichtlichen
Schein zu durchbrechen, müssen die scheinbar
vereinzelten Tatsachen in ihrer Beziehung zum Ganzen
gesehen werden. „Die Produktionsverhältnisse jeder
Gesellschaft bilden ein Ganzes", sagt Marx (54), und das
gleiche gilt für das gesellschaftliche Sein überhaupt.
Eine Erkenntnis der Wirklichkeit ist also erst dann
zutreffend, wenn die einzelnen Tatsachen des
gesellschaftlichen Lebens als Momente der sozialen
Totalität erfaßt werden. Die Isolierung der Tatsachen
ist nur ein Produkt der Verdinglichung und verhüllt die
Kerngestalt, ihren inneren Zusammenhang. Ein Empirismus
oder Positivismus, der es versucht, die Tatsachen so
vereinzelt darzustellen und sie nur begrifflich zu
verbinden, ohne ihre reale Verbundenheit zu sehen, ist
trotz des besonders exakten Aussehens einer solchen
Theorie in Wirklichkeit durchaus unwissenschaftlich.
„Die Roheit und Begriffslosigkeit" einer solchen
Betrachtungsweise liegt nach Marx(55) „eben darin, das
organisch Zusammengehörende zufällig aufeinander zu
beziehen, in einen bloßen Reflexionszusammenhang zu
bringen."
Das Ganze ist nicht die Summe der Teile, sondern die
Teile finden ihre Bedeutung in ihrer Beziehung auf das
Ganze, durch ihre Einordnung in die Totalität. Die
Kategorie der Totalität hebt nun aber nicht etwa die
Einzelmomente auf, wird nicht zu einer unterschiedslosen
Einheitlichkeit, in der die konkreten Erscheinungen
verschwinden. Nur der Schein des Eigenlebens der
Glieder, der Menschen, der Dinge, der Wissensgebiete
wird zerstört und durch die dialektisch-dynamische
Beziehung zum Ganzen und zueinander im Rahmen des Ganzen
ersetzt. Für die Oekonomie drückt Marx das treffend aus
(56): „Das Resultat, zu dem wir gelangen, ist nicht, daß
Produktion, Distribution, Konsumtion identisch sind,
sondern daß sie alle Glieder einer Totalität bilden.
Unterschiede innerhalb einer Einheit . . . Eine
bestimmte Form der Produktion bestimmt also bestimmte
Formen der Konsumtion, Distribution, des Austausches und
bestimmte Verhältnisse dieser verschiedenen Momente zu
einander ... es findet Wechselwirkung zwischen den
verschiedenen Momenten statt." Und er fügt hinzu: „Dies
ist der Fall bei jedem organischen Ganzen." Erst dieses
Verhältnis zum Ganzen bestimmt die
Gegenständlichkeitsform der Einzelerscheinung. Nur die
Stellung innerhalb des Gesamtzusammenhanges der
kapitalistischen Gesellschaft macht eine Maschine zu
Kapital, ein Produkt zur Ware. Sie verleiht jedoch den
Dingen den Schein von Eigenschaften, die ihrer
Sachgestalt in Wirklichkeit nicht anhaften.
Die Richtung der Erkenntnis auf das Ganze ermöglicht
es, diesen Schein zu durchbrechen, diese scheinbaren
Eigenschaften der Sachen, die scheinbare Bewegung von
Sachen zu durchschauen und dahinter die Beziehungen der
Menschen selbst zueinander zu sehen. Die Entfremdung der
Arbeit wird auf diese Weise erkannt, der fetischistische
Schein der Warenproduktion aufgehoben. Nun erst ist es
möglich, die Bewegung der menschlichen Gesellschaft in
ihrer inneren Gesetzlichkeit, zugleich als Produkt der
Menschen selbst und von Kräften, die, aus ihren
Beziehungen entstanden, sich ihrer Kontrolle entzogen
haben, zu begreifen. Die Kategorie der konkreten
Totalität deckt so als zentrale Kategorie der Dialektik
den humanistischen Charakter des Marxismus auf. Sie ist
die eigentliche Wirklichkeitskategorie(57). Damit ist
ein Wirklichkeitsbegriff gewonnen, der es erlaubt, das
Bewußtsein auf seine Ueber-einstimmung mit der
Wirklichkeit und damit auf seine Ideologiehaftigkeit hin
zu prüfen. Die Ideologie ist nun insofern falsches,
partikulares Bewußtsein, als sie ihren Gegenstand nicht
in seiner konkreten Totalität erfaßt, der ganzen
Wirklichkeit also nicht adäquat ist.
III.
Die Bedeutung der Ideologie
Aber die Ideologie ist mehr als nur falsches
Bewußtsein. Sie ist nicht nur eine subjektive
„Hirnweberei", sondern bewußtseinsmäßiger Ausdruck des
objektiven Scheins, den die kapitalistische Wirklichkeit
annimmt. Sie ist -- als bewußtes Sein -- selbst ein
wesentlicher und notwendiger Teil dieser Wirklichkeit,
der Begriff, der der realen Existenz der Oberfläche
entspricht, im Gegensatz zum richtigen, totalen
Bewußtsein, das außer der Oberfläche auch die
Kerngestalt, das Wesen der Verhältnisse erfaßt. Die
materiellen Verhältnisse bilden nur zusammen mit der
Ideologie die Wirklichkeit der bürgerlichen
Gesellschaft.
Die Ideologien der kapitalistischen Gesellschaft
entsprechen einer ökonomischen Basis, die das Organische
auseinanderreißt, den Menschen zur Sache, und das
menschliche Arbeitsprodukt zum handelnden Subjekt macht.
Ideologisch ist daher vor allem die Vorstellung von der
Unabhängigkeit der einzelnen Vorstellungs- und
Wissensgebiete von einander und von ihrer
sozial-ökonomischen Basis, ideologisch ist die Trennung
des Bewußtseins von seinem Gegenstande, die Zerreißung
der Einheit von Bewußtsein und Sein, ideologisch ist die
rein kontemplative Erkenntnis. Ideologisch aber ist auch
der gesamte Ueberbau der menschlichen Vorstellungen,
insofern als er scheinbar unabhängig vom
politisch-rechtlichen Ueberbau und von der ökonomischen
Grundlage ist. Die scheinbare Selbständigkeit des
Ueberbaus ist die wichtigste Form der Ideologie(58). Die
ideologischen „Empfindungen, Illusionen, Denkweisen und
Lebensanschauungen'', scheinbar losgelöst von ihren
materiellen Grundlagen, sind die subjektiven Motive für
die Handlungen des einzelnen Menschen, die zugleich
objektiv seinem sozialen Sein entsprechen. „Das einzelne
Individuum, dem sie durch Tradition und Erziehung
zufließen, kann sich einbilden, daß sie die eigentlichen
Bestimmungsgründe und Ausgangspunkte seines Handelns
bilden"(59). Es zeigt sich also, daß der Ueberbau der
bürgerlichen Gesellschaft ideologisch, auch im engeren
Sinne dieses Wortes, ist. Dennoch wird er nicht zu einem
gegenstandslosen Hirngespinst, sondern ist ein Teil
jener gesellschaftlichen Wirklichkeit des Kapitalismus,
die der Marxismus nicht nur theoretisch kritisieren,
sondern auch praktisch gegenständlich umwälzen will.
Anmerkungen
39) Brief an Mehring vom 14. 7. 1893.
39) Ideologie und Utopie. Einleitung, besonders S. 7 ff.
40) Mannheim, a. a. O., S. 9/10
41) Mannheim, a.
a. 0., S. 116/7.
42) Politik als Beruf, Ges. pol.
Schriften, S. 446.
43) Mannheim, a. a. 0., S. 30.
44) Ebenda S. 32—35.
45) Ebenda S. 40.
46) Mannheim, a. a. 0., S. 52/3.
47) Ebenda S. 116/7.
48) Vgl. dazu das folgende Kapitel.
49) Das Kapital, 1II/1, S. 188.
50) Engels, Ludwig Feuerbach, S. 52.
51) Zur Kritik der Politischen Oekonomie, S.
XV
52) Vgl. Korsch, Die materialistische
Geschichtsauffassung, S. 47 ff.
53) Lukäcs, a .a. O., S. 22.
54) Das Elend der Philosophie, S. 91.
55) Zur Kritik
der politischen Oekonomie, S. XIX.
56) Marx ebenda. S. XXXIV.
57) Vgl. Lukäcs, a. a. 0., S. 28.
58) Vgl. dazu auch Engels, Ludwig Feuerbach, S. 62 ff.
59) Marx, 'der 18. Brumaire, S. 49.
Editorische Hinweise
OCR-Scan von red. trend, S.85-95