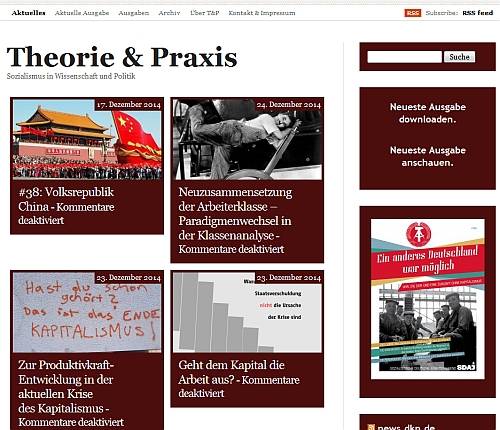|
Geht dem Kapital die
Arbeit aus? |
01-2015 |
|
|
Erstaunlich, dass die Debatte [1] ungerührt an dem schon 1987 von Robert Solow beobachteten Paradoxon – „Du kannst das Computerzeitalter überall sehen außer in den Produktivitätsstatistiken“ – vorbeigeht, das von Erik Brynjolfsson 1993 gründlich untersucht wurde [2]. Seither sucht man nach Erklärungen für diesen Befund. Sie reichen von der Antwort „Man kann den Produktivitätsfortschritt vielleicht nur nicht richtig messen“ bis zur Spekulation auf eine Langzeitwirkung. Nun ist inzwischen – gemessen an den raschen Produktivkraftänderungen – eine beträchtliche Zeit vergangen, ohne dass sich an dem Befund etwas geändert hätte. Jedenfalls kann keine Rede davon sein, dass die dritte industrielle Revolution zu einem historisch einmaligen Produktivitätssprung geführt hätte. Sinkende Profitrate Der Gedanke, dem Kapital gehe die Wert schaffende Arbeit aus, kann nur einem eurozentrischen Blick entspringen. Weltweit wächst das Proletariat weiterhin. Doch auch in den zunehmend deindustrialisierten Kernländern der EU stagniert das Arbeitszeitvolumen oder nimmt schwach zu. Am Verschwinden der Arbeit kann die Krise also nicht festgemacht werden. Die gegenwärtige Krise greift tatsächlich tiefer als es die Rede von der „stinknormalen Überproduktionskrise“ vorgibt und lässt sich erst recht nicht aus der Zirkulationssphäre heraus erklären – aber in einem ganz anderen Sinne als Lohoff/Trenkle und Manfred Sohn meinen. Einigkeit herrscht offenbar über die Diagnose: chronische Überakkumulation. Aber worin ist sie begründet? Was wir jetzt beobachten können, ist die Erscheinung eines Problems, das sich in einer Jahrzehnte langen Entwicklung aufgestaut hat, dessen Ursache letztlich im Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate liegt. Wir haben gesehen, dass ein Ende der Arbeit noch nicht einmal in den entwickelten kapitalistischen Ländern abzusehen ist. Solange in der Welt noch Bevölkerungsteile existieren, die noch nicht real dem Kapital subsummiert sind, wird letzteres nicht rasten und ruhen, bis der letzte chinesische Bauer proletarisiert ist. Die Entwicklung der Profitrate hängt im Wesentlichen vom Verhältnis der Wachstumsrate der Arbeiterpopulation zur Investitionsrate ab. Je größer dieses Verhältnis, desto höher die Profitrate und umgekehrt. Die These klingt zunächst erstaunlich. Doch hat bereits Marx diesen Sachverhalt thematisiert [3]. Er beschäftigt sich mit einer Situation, in der „Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung“ herrscht – eine Situation, die wir heute bei uns vorfinden. Die Überakkumulation von Kapital ist noch keine absolute. Eine absolute Überakkumulation läge vor, sobald „das Kapital gewachsen wäre in einem Verhältnis zur Arbeiterbevölkerung, dass weder die absolute Arbeitszeit, die diese Bevölkerung liefert, ausgedehnt, noch die relative Mehrarbeitszeit erweitert werden könnte (das letztere wäre ohnehin nicht tubar in einem Fall, wo die Nachfrage nach Arbeit so stark, also Tendenz zum Steigen der Löhne); wo also das gewachsene Kapital nur ebenso viel oder selbst weniger Mehrwertmasse produziert als vor seinem Wachstum“ [4]. Dies muss, so Marx weiter, zu einem Fall der Profitrate führen, die jetzt nicht der durch die Produktivkraftentwicklung verursachten höheren organischen Zusammensetzung des Kapitals geschuldet ist, sondern der gesunkenen Mehrwertrate. Aus der These folgt, dass in einer stagnierenden oder zurückgehenden Bevölkerung die Profitrate gegen Null tendiert und damit eine produktive Expansion der kapitalistischen Produktionsweise unmöglich wird. Diese Situation drohte in Großbritannien um 1980 herum ganz akut (in der BRD in abgeschwächter Form), und wäre GB ein abgeschlossenes ökonomisches System, wäre das Land vielleicht dem Sozialismus entgegengetaumelt. Relative Lösung Die Nachkriegsentwicklung der kapitalistischen Kernländer illustriert die These. Wir können dabei die Entwicklung in der BRD pars pro toto betrachten. Nach den Verwüstungen des 2. Weltkrieges können wir eine 30-jährige, von gravierenden äußeren Einflüssen freie, kapitalistische Entwicklung beobachten: Hohes Wachstum der arbeitenden Bevölkerung bei hohen Akkumulationsraten. Eine hohe Akkumulationsrate impliziert eine hohe Investitionsrate, die die Profitrate senkt, wenn nicht durch Erhöhung der Arbeitsproduktivität oder stärkeres Wachstum der Bevölkerung ein Gegengewicht entsteht. Das Wachstum der Arbeitsproduktivität blieb von 1960 an (wo es schon relativ hoch war) in der Tendenz konstant; das Potenzial an ausbeutbaren Arbeitskräften wurde allmählich absorbiert. Die Gewerkschaften waren dadurch in einer starken Position und konnten vergleichsweise hohe Löhne durchsetzen. Auf Grund des oben angegebenen Zusammenhangs begannen die Profitraten zu sinken und erreichten Anfang der 1980er Jahre ihren Tiefpunkt. Das Kapital steuerte auf zweierlei Weise dagegen: 1. Anheuerung von „Gastarbeitern“ und Produktionsverlagerungen zunächst vor allem nach Ostasien (nach der Konterrevolution auch in die ost- und südosteuropäischen Länder) zur relativen Erhöhung der Arbeiterpopulation. 2. Zurückfahren der produktiven Investitionen zugunsten von Investitionen in Finanztiteln [5]. Beide Maßnahmen befördern nach der These die Erhöhung der Profitraten. Das Kapital in den entwickelten westlichen Industriestaaten konnte sich erfolgreich aus einer schwierigen Verwertungssituation winden. Schlagend ist der Verlauf der Profitratenentwicklung in diesen Ländern: Rückgang von ungefähr 1960 an, mit Tiefpunkt Anfang der 1980er Jahre, danach der Aufstieg. [6] Die relative Lösung der Widersprüche durch die westlichen Industriestaaten hat ihren Preis: Sie reproduzieren sich auf höherer Ebene. Heute befindet sich China in einer Akkumulationsphase, die mit der Nachkriegsentwicklung bei uns vergleichbar ist. Aber: Wenn die Proletarisierung der Landbevölkerung abgeschlossen ist, steht China der Ausweg der westlichen kapitalistischen Hauptmächte nicht mehr zur Verfügung. Für die weitere relative Erhöhung der Arbeiterpopulation bliebe nur Afrika. Das wird aber nicht reichen. Wenn es denn so weit ist, in vielleicht knapp 20 Jahren, hätte die Arbeiterklasse weltweit objektiv die besseren Karten. Doch ist das kein Trost, denn diese Entwicklung vollzieht sich unter den Konkurrenzbedingungen des Kapitals, das sich seit gut 100 Jahren als Imperialismus formiert hat. Und das bedeutet: Kampf um die Neuaufteilung der Welt mit all seinen schrecklichen Implikationen. Schuldenschnitt als Strategie Manfred Sohn hat Recht, wenn er die Beantwortung der Frage nach dem Charakter der gegenwärtigen Krise für den Dreh- und Angelpunkt von Strategie und Taktik hält. Unterschiedliche Analysen führen zu unterschiedlichen Strategien. Lohoff/Trenkle sagen von vornherein, dass die Theorie nichts zu einer gesellschaftlichen Alternative beitragen könne. Sohn selbst hält sich mit strategischen Schlussfolgerungen zurück und lässt die Leserinnen und Leser mit der Aussicht auf einen „langen, bitteren, gefährlichen Niedergangsprozess“ im Regen stehen. Auch Inge Humburgs Schlussfolgerungen aus der von ihr geteilten Analyse Lohoff/Trenkles sind eigentlich keine strategischen, sondern beschreiben nur, was alles droht: kein Spielraum für Reformen mehr und Übergang zur terroristischen Herrschaft des Finanzkapitals – was aber, so scheint mir, für jede denkbare Weiterentwicklung des gegenwärtigen Imperialismus gilt, wenn man nicht gerade an eine Rückkehr des rheinischen Kapitalismus glaubt. Wenn man die These vom Dahinschmelzen der Wert schaffenden Arbeit ernst nimmt, folgt daraus nicht in logischer Konsequenz, dass die historische Mission der „verschwindenden Arbeiterklasse“ übergeht an die übergroße Mehrheit der Ausgestoßenen, Entrechteten und Dahinvegetierenden, die „von außen“ zum Sturm auf die Verwertungsinseln blasen? Die kommunistische Partei verlöre ihre Existenzberechtigung und würde mit Zizek, Badiou und wie sie alle heißen auf das revolutionäre „wahre Ereignis“ warten. Und auch Manfred Sohn wäre in der Linkspartei wohl nicht mehr am rechten Platz. Die von mir skizzierte Analyse führt allerdings zu anderen Konsequenzen. Durch das Zurückfahren der Investitionen sind die kapitalistischen Hauptländer zum beträchtlichen Teil zu Rentiersstaaten geworden. Das enthebt natürlich noch in keiner Weise die Arbeiterklasse der Weiterführung des Klassenkampfs in der „Verwertungssphäre“. Doch legt es einen flankierenden Angriff auf die bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnisse nahe: Ein Ansatzpunkt, der ein ökonomischer ist aber darüber hinausweist, wäre: ein radikaler Schuldenschnitt. Eine allgemeine Schuldenamnestie könnte man auf eine bestimmte Einlagenhöhe begrenzen [7]. Getroffen würde die dominierende Schicht der Rentiers, während die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung ungeschoren bliebe. Rentiereinkommen ist schwerer zu legitimieren als Profite der industriellen Unternehmer. Die kapitalistische Marktwirtschaft stünde noch ziemlich unangefochten da. Es wäre eine antimonopolistische, aber natürlich noch keine antikapitalistische Maßnahme. Banken würden paradoxer Weise wieder liquide. Ihre Verbindlichkeiten ständen in einem vernünftigen Verhältnis zu ihrem Geldmittelbestand. Die Industrie würde kaum beeinträchtigt (außer z. B. Luxusgüterproduktion) und bliebe weiterhin privat organisiert. Ob die Kapitalisten allerdings Lust haben, sich mit geringeren Profitraten zu begnügen (VW z. B. fährt 60 Prozent seiner Gewinne über „Finanzdienstleistungen“ ein), steht auf einem anderen Blatt. Der Druck in Richtung zukünftiger Produktionsweise würde wachsen. Quellen und Anmerkungen:
|
||
|
|
||