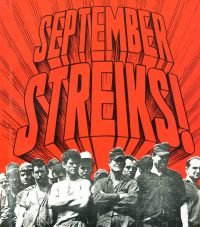
Materialsammlung zu den Filmveranstaltungen im September 2009
Klöckner-Streik
WILDER STREIK IN DER KLÖCKNERHÜTTE BREMEN
VOM ANTIGEWERKSCHAFTLICHEN ZUM ANTIKAPITALISTISCHEN KAMPF
von der Redaktion der Roten Pressekonferenz (RPK)
Von 1958 mit Beginn der Existenz der Klöcknerhütte bis
1966 stand die Arbeit des Betriebsrats unter kommunistischem Einfluß. Max
Müller, heute Mitglied der DKP war während dieser Zeit durchgängig,
zunächst kommissarischer, dann gewählter Betriebsratsvorsitzender. 1964
bis 1966 verstärkte sich der Einfluß der Kommunisten auf den Betriebsrat
in einem für die Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbürokratie Bremens
nicht mehr akzeptierbarem Maße. Bei den Betriebsratswahlen 1966 ergab sich
aufgrund geschickter Manipulation in der Wahlpropaganda (geschickte
Plazierung der Sozialdemokraten auf der Kandidatenliste,
informationsgraphische Tricks usw.) eine sozialdemokratische Mehrheit im
Betriebsrat unter Vorsitz des Opportunisten Prott. Mithilfe der
SPD-Mehrheit wurden die linken Arbeitervertreter, die immerhin erhebliche
Stimmen auf sich hatten vereinen können, rigoros aus allen Funktionen des
Betriebsrats und der Gewerkschaftskommissionen entfernt. Z. B. wurde der
mit der zweithöchsten Stimmenzahl gewählte Max Müller kurzerhand zur
Beaufsichtigung des Küchendienstes abgeschoben, weil er als Kommunist der
Gewerkschaft schon lange ein Dorn im Auge war. Ende Mai 1968 wurde der 2.
Betriebsratsvorsitzende Benno Schütter fristlos entlassen, nachdem er die
Angestellten für ein geschlossenes Auftreten der gesamten Belegschaft bei
den Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze agitiert hatte. In dem Prozeß, den Schütter daraufhin gegen Klöckner vor dem Arbeitsgericht
anstrengte, trat Prott als Hauptzeuge gegen Schütter auf. Bestechung der
Werksleitung machte Leute vom Schlage Protts vollends zu
Arbeiterverrätern.
Trotz dieser Manipulationen der Bremer Reaktion, kam es während der
Schulerdemonstrationen gegen die Fahrpreiserhöhung der Straßenbahnen zu
Solidaritätsaktionen der Klöcknerarbeiter. In der Antinotstandskampagne
beteiligten sich die Klöcknerarbeiter ebenfalls trotz innerbetrieblicher
Abwiegelungsversuche durch die IG Metall am Sternmarsch auf Bonn und an
einer Kundgebung in Bremen.
Immer wieder gelang es den Klöcknerarbeitern, vorbereitet durch eine
jahrelange linke Betriebsratspolitik, selbst den opportunistischen
SPD-Betriebsrat der Jahre 1966 bis 1969 zu offiziellen
Solidaritätserklärungen mit der kämpfenden Linken (APO) zu zwingen. Die
Folge war zunächst eine personalistisch verschleierte, schließlich
zunehmend offenere politische Fraktionierung innerhalb des Betriebsrates
gegen die Gewerkschaftsbürokratie. Die Klöcknerarbeiter kämpften sich auf
diese Weise zäh ihre spätere Führung aus den Fesseln der Gewerkschaft
frei. Während der Tarifverhandlungen im Sommer 1968 hatte die
Klöcknerbelegschaft ursprünglich eine 10%ige Lohnerhöhung gefordert. Sie
reduzierte diese Forderung zwar um 2 auf 8 %, hielt aer in darauf
folgenden Auseinandersetzungen dieser Kompromißforderung gegenüber den für
Nordrhein-Westfalen ausgehandelten 7% unerbittlich fest. In einer
Urabstimmung erklärten sich 84, 7% der Belegschaft bereit, diese Forderung
notfalls in einem Streik durchzusetzen. In letzter Sekunde gelang es der
Gewerkschaftsbürokratie, die Klöcknerarbeiter noch einmal übers Ohr zu
hauen. Diese Niederlage befähigte die Klöcknerarbeiter, den Kampf gegen
die Gewerkschaftsbürokratie jetzt direkt aufzunehmen, ihn auf einer
qualifizierteren Stufe innerhalb des antigewerkschaftlichen Kampfes neu zu
beginnen. Bei der Betriebsratswahl im Mai 1969 weigerte sich die
Belegschaft, die von der Gewerkschaft offiziell präsentierte
Kandidatenliste zu akzeptieren und setzte ihre linke Führung auf eine
Gegenliste, die sogenannte Liste 2. Die Kandidaten dieser Liste,
Kommunisten, Parteilose und wilde innerbetriebliche Kader konnten mit
Benno Schütter an der Spitze, der zu dieser Zeit schon Werksverbot hatte,
die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen. Es ergab sich das
außerordentliche Politikum nicht nur eines von der Gewerkschaft nicht
anerkannten Betriebsrates - gegen die 41 von der 2. Liste waren
Ausschlußverfahren eingeleitet worden -, sondern dieser "Betriebsrat mußte,
da Bonno Schütter als Vorsitzender fungierte, zudem noch außerhalb des
Werkgeländes tagen.
Durch diesen Betriebsrat, dem objektiv jeglicher Boden
für die ihm instituitionell angestammte Vermittlerrolle entzogen war,
versetzten sich die Klöcknerarbeiter tendenziell in die Lage, den
Lohnkampf 69 aus der vom Kapital diktierten Kanalisierung
herauszusprengen. Erst der im wilden Streik entfesselte Lohnkampf legt den
Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital wieder frei. Im Lohnkampf 69
entfalteten die Klöcknerarbeiter den Grundwiderspruch in der Form des
antikapitalistischen Kampfes, der versteckter Klassenkampf ist und zur
Vorform des revolutionären Kampfes gemacht werden muß.
2. ZUR LAGE DER KLÖCKNERARBEITER
Die Klöcknerbelegschaft rekrutierte sich in der Aufbauphase der Hütte (sie
wurde 1958 gegründet) hauptsächlich aus der linksliberalen bis
linksradikalen Belegschaft der bankrott gegangenen Borgwardwerke. Die
Borgwardarbeiter haben mit Beendigung der Rekonstruktionsperiode Ende der
50iger Jahre als erste den Krisencharakter des westdeutschen Kapitalismus
zu spüren bekommen. Die - wenn auch kurzfristige - Existenzunsicherheit,
der folgende Zwang zur Umschulung beim Wechsel aus der
metallverarbeitenden in die stahlerzeugende Industrie und die sich daran
knüpfende anfängliche Verschlechterung der materiellen Lage sind
Erfahrungen, die den für das westdeutsche Proletariat exemplarischen
Charakter des Bewußtseins der Bremer Klöcknerarbeiter entscheidend
mitbestimmt haben.
Mit ca. 6 000 Beschäftigten ist die Klöcknerhütte in Bremen eines der
großen Werke im norddeutschen Raum. Allein für das kommende Jahr sind für
die Hütte Bremen 540 Millionen DM an Investitionen vorgesehen. Die Hütte
wurde bei ihrer Gründung vor 10 Jahren mit dem damals modernsten
Siemens-Martinverfahren ausgerüstet. Inzwischen ist die Hütte fast völlig
auf das neue LD-Verfahren umgerüstet worden. Der außerordentlich hohe Grad
an technischer Rationalisierung, der dadurch erreicht wurde, läßt sich an
der Relation des Produktionsausstoßes zur Anzahl der unmittelbar in der
Stahlproduktion tätigen Arbeiter ablesen:
Vor der Umrüstung wurden von 700 Arbeitern 130 000 Tonnen Stahl pro Monat
hergestellt, nach der Umrüstung produzieren 380 Arbeiter 280 000 Tonnen
Stahl pro Monat. Das bedeutet eine Steigerung der Produktivität um nahezu
400%. Die Arbeiter, die vom SM Stahlwerk ins LD Stahlwerk überwechseln
mußten, waren von erheblichem Lohnabbau betroffen - in einigen Fällen bis
zu DM 1, 30 pro Stunde. Drei Momente sind vorrangig hierfür verantwortlich
zu machen
1. die hochrationalisierte Stahlproduktion bedarf kaum noch der
qualifizierten Facharbeit. Extremer denn je fungiert der Arbeiter als
Lückenbüßer der Maschinerie. Der Schutz, den der Facharbeiterbrief bei
früherem Arbeitsplatzwechsel für den Arbeiter bedeutete, wird bei
zunehmender Rationalisierung der Arbeitsplätze zum verschwindenden Faktor.
Der Wechsel von den SM-Arbeitsplätzen zu den LD-Arbeitsplätzen bedeutete
für die Klöcknerarbeiter eine von der Unternehmensleitung als "Umschulung"
getarnte Dequalifizierung ihrer Arbeit. Um den profitheischenden Sinn der
verschleierten Dequalifizierung, nämlich geplante Kostensenkung auf dem
Rücken der Arbeiter durchzusetzen, sollten "Umschulungskosten" den
Arbeitern ihre Lohnrückstufungen um 2-3 Gruppen plausibel machen.
2. Dem Lohnabbau leisten vor allem aber die für die Stahlindustrie
existierenden Tarifverträge selber Vorschub. Ihr Lohnzumessungssystem
basiert nicht etwa auf dem Produktivitätsniveau, sondern auf einem
analytischen Arbeitsplatzbewertungssystem, dessen hervorstechendste
Eigenschaft es ist, daß der Lohn bei geringer werdender körperlicher
Belastung sinkt. Solche Tarifgrundlagen schafften der technischen
Rationalisierung in der Stahlindustrie erst grünes Licht.
3. Der dem Arbeitsplatzbewertungssystem zugeordnete Erschwerniskatalog,
aus dem sich ein Teil der Lohnzulagen ableitet, wie bei Klöckner
praktiziert, kann im Zuge der Rationalisierung durch manipulative
Gestaltung der Arbeitsplätze als Quelle der Lohnerhöhung beliebig
ausgeschaltet werden. Schmutz etwa wird diesem Katalog zufolge mit einer
hohen, Hitze mit einer niedrigen Zulage bewertet: also sind die
Arbeitsplätze in dem neuen LD-Stahlwerk sauber und heiß.
Diese direkt aus der kapitalistischen Weise der Rationalisierung resultierende Verschlechterung der Lohnsituation wird verschärft durch die indirekten, für das Kapital weniger eindeutig kontrollierbaren, Konsequenzen der Rationalisierung. Die große Masse der Klöcknerarbeiter (etwa 4 000 von 5 000) arbeitet in der der komplizierten Produktionsanlage zugeordneten werkseigenen Reparaturbetrieben. Aus ihrer Arbeitskraft vor allem versucht das Kapital, die Kosten für die Rationalisierungsinvestitionen wieder herauszuholen.
Die Arbeitsbedingungen sind schlecht, die Arbeit unterbezahlt Kein Schlosser oder Elektriker arbeitet länger als 2-3 Jahre direkt für Klöckner. Der hieraus resultierenden hohen Fluktuation und dem Arbeitskräftemangel wirkte die Werksleitung nicht durch eine Besserstellung der Arbeiter entgegen. Sie leiht sich je nach Auftragslage Reparaturarbeiter bei anderen Firmen aus, deren Löhne zwangsläufig weit über denen der werkseigenen Arbeiter liegen, und dies gewiß nicht zum Schaden der Reparaturunternehmen. Den Klöcknerarbeitern fiel es nicht schwer, aus diesem riskanten Anschauungsunterricht über unmittelbare Profitmaximierung zu lernen.
Unter den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, von den langen Wegen zu schlechten Toiletten, über miserable Pausenunterkünfte bis hin zur Lebensgefahr für die Arbeiter an den beiden letzten noch arbeitenden SM-Hochöfen, die infolge der glänzenden Auftragslage mit überhöhter Tonnenzahl gefahren werden müssen, sei eine besonders hervorgehobene ie der ununterbrochen arbeitenden Produktionsanlage total angepaßten Arbeitszeiten nach dem Schichtenrhythmus. Die normale 4-wöchentliche Arbeitszeit unterliegt folgendem Schichtenablauf:
1. Woche: Montag bis Samstag Frühschicht, 6-14 Uhr
Sonntag 6-18 Uhr
2. Woche: Montag bis Mittwoch Spätschicht 14-22 Uhr 4 Tage frei
3. Woche: Montag bis Samstag Nachtschicht 22-6 Uhr Sonntag 18-6 Uhr
4. Woche: 3 Tage frei, Donnerstag bis Samstag Spätschicht, 14-22 Uhr
Sonntag frei
usw. Das sind 168 Stunden im Monat. Um auf die 40-Stunden-Woche zu kommen,
wird in jede Frühschicht ein sogenannter "Waschtag", eine Freischicht
eingeschoben. Klar ist, daß vor allem dieser freie Tag, wie auch der
vierte Sonntag Freischichten sind, die sich für Überstundenarbeit bis zu
200 Stunden monatlich anbieten. Der Schichtenrhythmus ist ein weiterer
Grund für die hohe Fluktuation. Man hält ihn nicht lange aus. Das Klöckner
Werk liegt etwa 10 Kilometer vom Zentrum Bremens entfernt im
Industriehafen. Nur wenige Klöcknerarbeiter wohnen in den relativ nahe
gelegenen ehemals proletarischen Vierteln Gröpelingen oder Valle. Nachdem
Valle im 2. Weltkrieg fast völlig zerstört worden war, zog der größte Teil
des Bremer Proletariats in die Parzellengebiete zwischen dem Bürgerpark
und Oslebshausen, in denen es bis heute keine Kanalisation und
Wasserzapfstellen nur an jeder zweiten Straßenecke gibt. Nur zögernd
lassen sie sich von hier aussiedeln in den sogenannten sozialen
Wohnungsbau von Satellitenstädten wie der "Neuen Vahr". Die Mieten sind zu
hoch (bis zu DM 300 für drei Zimmer), die Wohnungen zu klein und zu
isoliert voneinander. Ehemalige Kleingärtnervereine vor allem, wie
"Blockland" und "Blüh auf" organisieren den Widerstand. Klöcknerarbeiter.
die nicht in den Satellitenstädten oder den Parzellengebieten wohnen,
kommen aus Zeven, Bremerhaven oder Delmenhorst mit Anfahrtswegen bis zu
zwei Stunden zur Arbeit in die Hütte. Für diese Arbeiter, (ihre genaue
Zahl konnten wir nicht ermitteln, sie muß aber relativ hoch sein, denn
sonst lohnte sich ein 'werkseigenes Transportsystem nicht) dauert der
Arbeitstag bis zu 12 Stunden. Jeden zweiten bzw. dritten Sonntag
verlängert er sich, da sonntags nur 12-stündige Schichten gefahren werden,
bis zu 16 Stunden.
Die Frauen der meisten Klöcknerarbeiter verdienen mit.
Sie arbeiten bei Nordmende, Siemens oder als Putzfrauen. Am Abend des
ersten Streiktages zogen sie zusammen mit ihren Männern vor das Werkstor.
Sie demonstrierten damit jene schon klassenmäßige proletarische
Solidarität, der sich die Werksleitung, die versprochen hatte, eine
Erklärung zu den Forderungen der Arbeiter abzugeben, nicht mehr zu stellen
wagte.
Der Streik wurde inititiert und getragen hauptsächlich von älteren
Arbeitern, die verheiratet sind und den Betrieb nicht mehr ohne weiteres
verlassen können. Die Angestellten zögerten anfangs, sich dem Streik
anzuschließen, obwohl die Lohnforderungen der Arbeiter Erhöhung auch ihrer
Gehälter bedeuteten, während des Streiks haben sie die Arbeiter nur mäßig
unterstützte Zwar bildeten sie vereinzelt mit den Arbeitern Streikposten,
in der großen Mehrheit jedoch verhielten sie sich passiv, ohne
Eigeninitiative, oder opportunistisch. Lehrlinge und jüngere Jungarbeiter,
die größtenteils von sich selbst behaupten, sie sympathisierten mit der
Linken und mit Sicherheit an den Bremer APO-Aktionen teilgenommen haben,
wirkten ebenfalls weder initiierend noch organisierend. Die 250-300
ausländischen Arbeiter (vor allem Türken), die in der völlig
unterbezahlten Verpackung mit Zweijahresverträgen arbeiten, und die
ebenfalls dort beschäftigten Frauen unter den Klöcknerarbeitern haben
aktiv mitgestreikt. Beide Parteiungen sind niemals Ursache von Spannungen
in der Klöcknerarbeiterschaft gewesen.
3. Die Entlohnung der Klöcknerarbeiter ist miserabel. Die Löhne liegen
sowohl weit unter denen der Stahlindustrie im Ruhrgebiet als auch unter
denen der übrigen Bremer Industrie. Der Ecklohn liegt bei einer
Lohngruppenskala von 10-2 bei der Lohngruppe 7 und beträgt zur Zeit ca. 3,
90 DM.
Der während der Rezession eingeleitete Lohnabbau in der
Stahlindustrie traf die Klöcknerarbeiter auf zweierlei Weise; einmal über
den von der Gewerkschaft eher geförderten als verhinderten Mechanismus
kapitalistischer Rationalisierung, zum anderen in Form von Kürzungen aller
vom Kapital in Zeiten der Hochkonjunktur zugestandenen, tariflich nicht
gesicherten Extras zum normalen Lohn. Während die Klöcknerarbeiter von der
Lohnkürzung durch Rationalisierung ungleichmäßig betroffen waren, machte
sich der Schwund der 1964 zugestandenen 30-Pfennig-Zulage pro verdienter
Mark auf traurige 11 1/2 Pfennige 1967 im Geldbeutel jedes einzelnen
Klöcknerarbeiters unverschleiert und einheitlich bemerkbar.
Von dem grandiosen Boom in der Stahlindustrie 1968/69, an dem sich
Klöckner dumm und dämlich verdiente i, handelten sich die Arbeiter
ausschließlich Überstunden ein und deren beschissenen Gegenwert. Statt 160
Stunden wurden bis zu 200 Stunden im Monat gefahren.
Die Ausbeutung war kaum noch zu steigern.
Die Sammlung der Arbeiter zum Kampf gegen die
unerträglich gewordene Ausbeutung konzentrierte sich inhaltlich von
vornherein auf zwei Losungen: "30 Pfennig für jede Mark" und "gleiche
Löhne". Die erste Losung enthielt das die Solidarisierung
auslösende Moment, da der Abbau der 30 Pfennig keinen Klöcknerarbeiter
ungeschoren gelassen hatte. Die zweite Losung konnte den solidarischen
Kampf weitertreiben und schließlich erfolgreich auf eine neue Stufe heben.
Indem sie die gewerkschaftliche abgesicherte Lohnhierarchie durchbricht,
durchkreuzt sie direkt die das Proletariat spaltende Strategie des
Kapitals. Monate vor Beginn des Streiks formierte sich der Kampf in
sporadischen Überstundenverweigerungen einzelner Abteilungen (die
Klöcknerarbeiter knüpften damit an eine Kampfform an, die in einer Reihe
von Bremer Elektrobetrieben zu Anfang des Jahres mit exemplarischem Erfolg
praktiziert worden war). Aber der Kampf gegen die miese Lohnsituation in
Form der Überstundenverweigerung führte zwangsläufig zu einer weiteren
Verschärfung der materiellen Lage (der stark geschrumpfte Lohn garantierte
kaum mehr das Existenzminimum). Erst der einmal beschlossene und begonnene
Kampf konnte das wahre Ausmaß der materiellen Notlage zutage fördern,
seine Notwendigkeit zunehmend klarer und eindeutiger im Bewußtsein der
Arbeiter festigen, sich dialektisch zur materiellen
Notlage bis hin zum Streik radikalieren.
Der 2 1/2 Monate vor Beginn des Streiks von der Belegschaft über die 2.
Liste erkämpfte Betriebsrat unterstützte die Überstundenverweigerung,
soweit das BVG dies zuließ. Er schrieb nur noch die für die Instandhaltung
der Produktionsanlagen erforderlichen Überstunden aus. Von seinem
Amtsantritt bis zum Streik konkretisierte er nur die erste noch
gewerkschaftliche Forderung der Arbeiter: Wiederaufstockung der
innerbetrieblichen Zulage auf 30 Pfennig pro verdiente Mark, d. h. für die
Ecklohngruppe 7 eine Erhöhung von 70 Pfennigen. Aber schon am ersten
Streiktag faßten die Arbeiter ihre ursprünglichen Losungen in einer
Konkretion zusammen, die die des Betriebsrats überholte. Sie forderten
eine Lohnerhöhung von absoluten 50 Pfennigen für alle Arbeiter.
Im Gegensatz zum Betriebsrat unterstützte der von SPD und Gewerkschaft
eingesetzte Vertrauensleutekörper den Streik nicht.
"DENKT AN HOESCH"
Der Streik, der auf die Nachrichten aus dem Ruhrgebiet "spontan" durch
einen 2-stündigen Warnstreik der Nachtschicht vom Donnerstag eingeleitet
wurde, war nach Aussagen von Klöcknerarbeitern schon so weit vorbereitet,
daß er auch ohne die Initialzündung "Hoesch" 4-6 Wochen später mit
Sicherheit durchgeführt worden wäre.
Freitag, neun Uhr: die Arbeiter im Kaltwalzwerk frühstücken und
frühstücken. Die Frühstückspause endet mit der Bildung eines Streiktrupps,
der vom Kaltwalzwerk zum Verwaltungsgebäude zieht, dort die 50 Pfennig
fordert und anschließend durch sämtliche Werke marschiert und zum Streik
aufruft. In direkter Konfrontation mit einer streikenden Belegschaft zeigt
sich die Unternehmensleitung bereit sofort 20 Pfennig, kurz darauf 30
Pfennig Lohnerhöhung auf den Ecklohn zuzugestehen. Die Streikenden lehnen
ab.
Um 13 Uhr kommt die Werksleitung mit Vertretern des Arbeitgeberverbands zu
einer Beratung der Lage zusammen, Ergebnis dieser Sitzung ist, mit der
Gewerkschaft in Verbindung zu treten und sie aufzufordern, um den Preis
vorgezogener Tarifverhandlungen ihre Rolle als Ordnungsfaktor wieder
wahrzunehmen.
Setzt das Kapital in Zeiten des "Betriebsfriedens" alles daran, die Macht
der Gewerkschaften einzuschränken, indem es versucht, die Tariflöhne
möglichst niedrig zu halten und mit betrieblichen Vertretern der Arbeiter
über jederzeit kündbare Sonderregelungen die eigentlichen Lohnerhöhungen
auszuhandeln, so scheut es andererseits in Zeiten von Arbeitskämpfen kein
Mittel, die Autorität der Gewerkschaften wieder herzustellen. Die
Gewerkschaften bleiben so Spielbälle der Kräfte, die den Grundwiderspruch
entfalten.
Noch in derselben Nacht wurde die Tarifkommission in Gelsenkirchen
einberufen.
Samstag früh um 2 Uhr liegt als Ergebnis dieser "Koalitionsgespräche" ein
40 Pfennig - Angebot der Direktion vor: von diesen 40 Pfennig auf den
Ecklohn hätten 10 auf jeden Fall, 30 im Falle einer mehr als Steigen
Erhöhung auf die Ergebnisse der kommenden Tarifverhandlungen angerechnet
werden sollen. Da aber von der IG Metall zu diesem Zeitpunkt bereits eine
14% Erhöhung gefordert wurde, war völlig klar, daß diese 40 Pfennig
bluffen sollten. Sie wären in ihrer Gänze unter den Tisch gefallen. Die
Arbeiter hätten für nichts gestreikt. Auch dieses Angebot wurde
ausgeschlagen. Bis Mittwoch erfolgte kein weiteres Angebot.
In der Zwischenzeit inszeniert die Werksleitung eine Hetzkampagne gegen
die Klöcknerarbeiter in der liberalen Öffentlichkeit. Im Zentrum steht das
sogenannte Mischerproblem. Der fast leere Mischer war noch am
Freitagnachmittag auf massiven Druck der Werksleitung mit dem flüssigen
Rohstahl aus den stillgelegten Hochöfen vollgekippt worden. Das war offene
Provokation der streikenden Arbeiter. Sie weigerten sich, den vollen
Mischer, der zu einem Stahldenkmal einzufrieren drohte, wieder zu
entleeren (da dies einer Wiederaufnahme der Produktion gleichgekommen
wäre). Die Werksleitung verleumdete das als frühkapitalistische
Maschinenstürmerei und versuchte so, die Kampfkraft der Arbeiter zu
paralysieren.
Die Gewerkschaften mochten nicht zurückstehen. Sie verbreiteten unter den
Arbeitern des Klöcknerstahlwerks und der Georgs-Marienhütte Osnabrück die
infame Lüge, die Bremer Arbeiter zerstörten Produktionsanlagen und hätten
einen Lokführer erschlagen. Sie seien gelenkt durch betriebsfremde
Gruppen. Zu erklären ist der brutale Charakter solcher Diffamierungen aus
der tiefsitzenden Furcht der Reaktion vor dem radikalisierenden Einfluß,
den die Klöcknerarbeiter bei Arbeitskämpfen traditionellerweise auf die
Arbeiterschaft ganz Norddeutschlands ausüben.
Mittwochmorgen offeriert die Betriebsleitung erneut ihr
20-Pfennig-Angebot vom Freitag. Die Arbeiter lehnen wiederum ab.
Diesmal per Abstimmung auf einer um 14 Uhr am Werkstor stattfindenden
Belegschaftsversammlung. Mehr als tausend Arbeiter erklären einmütig, den
Streik fortzusetzen. Zum ersten Mal treten Sprecher aus der Belegschaft
hervor. Darunter ein Türke. Die Stimmung ist Begeisterung. Sprechchöre
werden gebildet. Die Kampfbereitschaft ist ihrem Inhalt nach eindeutig
antikapitalistisch. Betriebsrat Florien an die Versammelten: "Das Gesetz
verbietet mir. Euch zu danken".
An diesem Mittwoch sind die Fronten klar. Der Kampf ist eindeutig
geworden. Weder den Kapitalisten noch den Arbeitern geht es mehr ums Geld.
Tendenziell ist die Machtfrage gestellt. Wer wen? Für die Arbeiter heißt
das, wie kann ihr Kampf gegen die Kapitalisten eine neue offensive Stufe
gewinnen) Entlang welcher Strategie;
Der im antigewerkschaftlichen Kampf geschaffene Betriebsrat, diese
uneinheitliche, verstohlene, von der Kraft der Massen in jeder Phase des
Streiks neu überraschte "Führung", findet sich Mittwoch vor eine
Alternative gestellt, die sich ihm verschließt. Weder ist er der
organisierte Kader, der die entschlossenen Massen organisierend im Kampf
gegen die herrschende Klasse anleiten kann, noch kann er zurück in den
Lakaienstatus des Vermittlers zwischen den Unternehmern und Arbeitern, die
sich den Kampf angesagt haben. Wo Entscheidungen getroffen werden müssen,
aber nicht getroffen werden können, blüht naturwüchsiger Opportunismus.
Die Handlungsunfähigkeit des Betriebsrats gebiert ein vielschichtiges
Überlegen über die vermeintlich von ihnen versäumte "rechtzeitige
Umfunktionierung" des Streiks und wie "man" hätte dieses oder jenes
verhindern können. Nicht wie man, die eigene Einstellung zu den Massen
korrigierend, sie in einen siegreichen Kampf hätte führen können, wurde
analysiert, sondern imaginäre Zeitpunkte wurden beschworen, zu denen man
die sich radikalisierenden Arbeiter hätte bremsen sollen,
selbstverständlich in deren ureigenstem "Interesse". Denn den Arbeitern
war, der Auffassung von Teilen des Betriebsrats zufolge, nicht klar, daß
sie einen Zweifrontenkampf führten, gegen die Unternehmer und gegen die
Gewerkschaften, und daß sie unterliegen mußten, wenn sie sich nicht auf
eine der Fronten konzentrierten. Man hätte zum rechten Zeitpunkt alle
Kräfte auf den Kampf gegen die Gewerkschaften, den angeschlageneren Gegner
vereinen müssen, indem man die Forderungen der IG-Metall nach Vorverlegung
der Tarifverhandlungen und nach 14%iger Lohnerhöhung zu Forderungen des
wilden Streiks gemacht hätte. Der Gewerkschaft wäre dadurch (angeblich)
der Wind aus den Segeln genommen worden. Diese imaginäre Strategie "post
festum" baute auf dem ebenso imaginären Hang der Arbeiter zum Ökonomismus.
Bei aller Radikalität ginge es den Arbeitern ja nur ums Geld, egal von
wem. Nach Meinung von Teilen des Betriebsrats wären die Arbeiter todsicher
auf den Trick der Gewerkschaften hereingefallen, deren Forderung von ca.
56 Pfennigen (=14%ige Erhöhung) für Lohngruppe 7 mit ihrer eigenen
Forderung nach 50 Pfennig auf jede Lohngruppe gleichzusetzen. Da wäre es
schon besser gewesen, die Arbeiter hätten bewußt von sich aus diese
Gleichsetzung vollzogen. Abgesehen von der opportunistischen Überschätzung
der "Macht" der Gewerkschaften zum Zeitpunkt der Streikwelle, steckt in
dieser Argumentation vor allem eine ungeheuerliche Unterschätzung, ja
Mißachtung der politischen Kraft der sich formie renden Arbeiter. Der
Betriebsrat hatte den klassenbildenden Sinn der 50 Pfennig-Forderung
offensichtlich nicht verstanden. Er hatte, irregeführt durch die Rolle,
die er selber in der vergangenen Phase des Kampfes gespielt hatte, nicht
begriffen, daß mit dem Sieg der Liste 2 der antigewerkschaftliche Kampf
der Arbeiter sich zu einem offen antikapitalistischen entwickelt hatte.
Donnerstag. Der naturwüchsige Opportunismus des Betriebsrats, der
hauptsächlich aus seiner objektiven Entscheidungsunfähigkeit resultierte,
zeigte sich aber nicht nur in der post festum entwickelten "Strategie der
verpaßten Gelegenheiten" und ihrer falschen Grundthese. Er wurde
schließlich auf den Belegschaftsversammlungen am Donnerstag zur Quelle
totaler Widerstandslosigkeit gegenüber den infamen Taktiken des Kapitals.
Auch die Abwiegelungsmanöver nährten sich aus ihm ohne direkt zum
Streikabbruch aufrufen zu müssen, sollten sie doch eindeutig
Abbruchwilligkeit bei der Arbeiterschaft erzeugen. Die Werksleitung hatte
am Morgen, zu einem Zeitpunkt, zu dem wenige Arbeiter auf dem Werksgelände
sind, zu einer Belegschaftsversammlung aufgerufen, zu der sie überdies die
Angestellten eigens per Post eingeladen hatte. Auf dieser
"Belegschaftsbasis" inszenierte sie, getarnt als Abstimmung über das
Schicksal des Mischers, eine Abstimmung über Abbruch oder Fortsetzung des
Streiks. Der Mischer sollte jetzt auf seine Verwendungsfähigkeit überprüft
werden, was eine wenn auch allmähliche so doch sichere Wiederaufnahme der
Produktion zur Folge haben mußte.
Dank der Unentschlossenheit, Uninformiertheit und partiell offenen
Arbeiterfeindlichkeit eines größeren Teils der Angestellten, die in der
absoluten Mehrheit waren, ergab die Abstimmung keine eindeutige Ablehnung
der Wiederaufnahme der Arbeit am Mischer.
Dieses Abstimmungsergebnis wirkte sich, wie geplant, paralysierend und
demoralisierend aus auf die l 500 Arbeiter Inder Nachmittagsversammlung.
Der Betriebsrat hatte sie einberufen unter dem Motto: "Die Belegschaft ist
guten Willens, sie möchte auch lieber arbeiten als streiken. Aber auch der
Konzern muß uns entgegenkommen."
Diffamierungen des Betriebsrats taten ein übriges. Auf die Feststellung
eines klassenbewußten Arbeiters, es sei lächerlich, jetzt für 20 Pfennig
wieder an die Arbeit zu gehen, antworte Müller, man wolle es hier nicht
mit Goebbels und seiner Parole "wollt ihr den totalen Krieg" halten.
Freitag wurde schließlich über den Zeitraum von drei Schichten hinweg über
Annahme oder Ablehnung des letzten Angebots der Geschäftsleitung (20
Pfennig auf den Ecklohn bei Nichtanrechnung der Streikschichten)
abgestimmt. Nur 54% der Belegschaft nahmen an dieser Abstimmung teil. Für
die Annahme stimmten 1415, für die Fortsetzung des Streiks 1195. Das
bedeutete sofortige Arbeitsaufnahme. Die Erbitterung unter den Arbeitern
ist sehr groß. Es wird wieder gerechnet. Manche kommen zu dem Ergebnis,
daß man 7 Monate arbeiten muß, bis sich die Lohnerhöhung bemerkbar macht.
4. ZUR ORGANISATION DES STREIKS
In der ersten Konfrontation mit der Unternehmensleitung, die versucht
hatte, über einen von ihr organisierten, personell weit überbesetzten
Notdienst die Produktion weiter laufen zu lassen, bildeten die bewußtesten
Arbeiter, Facharbeiter, teilweise sogar Meister einen eigenen NOTDIENST,
der mit drei Aufgaben betraut war:
1. die Wiederaufnahme der Produktion durch eventuelle Streikbrecher zu
verhindern,
2. die Produktionsanlagen zu warten und
3. Sabotageakte durch eingeschleuste Provokateure abzuwehren. Hierzu
gehörte auch die Überwachung des Werkschutzes, der zur Hälfte aus Spitzeln
besteht, der Notdienst war zugleich potentielle Streikleitung.
Die STREIKPOSTEN waren nicht zentral organisiert. Einander bekannte
Gruppen von Arbeitern lösten sich gegenseitig ab. Die Werkstore wurden auf
diese Weise permanent von durchschnittlich 500 Arbeitern bewacht. Jeder,
der ins Werk wollte, mußte eine dreifache Kontrolle passieren. Für den
Notdienst hatten die Streikposten ein System täglich andersfarbiger Karten
entwickelt, um das Eindringen von Provokateuren abzuwehren. Immer wieder
neu bildeten sich im Verlauf des Streiks Gruppen, die am Aufbau eines
INFORMATIONSnetzes arbeiteten. Die kursierenden Flugblätter enthielten
ausschließlich Informationen a^tfnisatorischer Art, mit Ausnahme eines
Flugzettels, mit Streikinformationen für die Arbeiter der anderen Bremer
Betriebe.
Das Prinzip der dialektischen Beziehung von Führung und Masse wurde in der Geschichte der Arbeiterbewegung und wird auch heute noch von kommunistischen Parteien wiederholt verletzt.
Daraus resultiert auch das berechtigte Misstrauen der
Arbeiter gegen kommunistische Parteien, wie es sich in der Reaktion der
Klöckner-Arbeiter auf Einmischungsversuche der DKP zeigt. Dieses Mißtrauen
ist nur dann gegen Resignation gefeit, wenn durch Arbeitskämpfe und
politische Schulung der Masse der Arbeiter klar wird, daß die Kader im
Kampf nur dadurch Kader sein können, und der Kampf nur dadurch in
aufsteigender Linie bis zur Revolution verläuft, wenn diese Kader nicht
ausschließlich im Betrieb verankert sind, sondern auch in einer
kommunistischen Partei, deren oberstes Prinzip "von den Massen lernen, in
die Massen tragen, aus den Massen schöpfen" ist.
Der Artikel erschien in
Rote Presse Korrespondenz
DER STUDENTEN-SCHÜLER-UND ARBEITERBEWEGUNG
1969, 1. Jg, Nr. 32, 26.9.1969,
S. 6-11
Redaktion: Solveig Ehrler, Günther Matthias Tripp,
Betriebsbasisgruppen. Ad-hoc-Gruppen an den Hochschulen, Internationales
Forschungsinstitut des SDS (INFI), Berufsbasisgruppen im Republikanischen
Club Berlin, Zentralrat der Sozialistischen Kinderläden
OCR-San by red. trend
virtuell erstveröffentlicht in Trend 10/2004